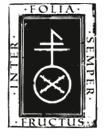LOGBUCH XLIX (5. Juli 2023). Von Till Kinzel
Der Literaturwissenschaftler Clive Staples Lewis (1898–1963) ist über das 20. Jahrhundert hinaus eine Ausnahmegestalt. Eine neue Biographie von Norbert Feinendegen zeigt, wie Lewis’ Denkweg über verschiedene Stadien von einem materialistischen Atheismus zu einem christlichen Theismus führte. Indem Feinendegen vor dem Hintergrund seiner exzellenten Lewis-Kenntnisse herausarbeitet, wie sich der englische Literaturwissenschaftler und Schriftsteller als homo religiosus entwickelte, entsteht ein faszinierendes Bild.
Der Literaturwissenschaftler Clive Staples Lewis (1898–1963) ist über das 20. Jahrhundert hinaus eine Ausnahmegestalt. Eine neue Biographie von Norbert Feinendegen zeigt, wie Lewis’ Denkweg über verschiedene Stadien von einem materialistischen Atheismus zu einem christlichen Theismus führte. Indem Feinendegen vor dem Hintergrund seiner exzellenten Lewis-Kenntnisse herausarbeitet, wie sich der englische Literaturwissenschaftler und Schriftsteller als homo religiosus entwickelte, entsteht ein faszinierendes Bild.
LOGBUCH XLVIII (14. Juni 2023). Von Daniel Zöllner
Im Herder-Verlag sind die Poetik-Vorlesungen erschienen, die der evangelische Theologe und Lyriker Christian Lehnert im Sommersemester 2022 in Wien gehalten hat. In diesen Vorlesungen wird die Sprache verstanden als Übergang zwischen Hier und Dort und ist demzufolge ein über sich hinausweisendes, zwangsläufig mangelhaftes Hilfsmittel, um das Unbekannte zu sondieren. Es ist dieses Sprachverständnis, das für Lehnert die Sprache der Religion mit der Sprache der Poesie verbindet. Beide Sprachformen lassen sich verstehen als „viatorisches“, also „pilgerndes Sprechen“ im Übergang.
Im Herder-Verlag sind die Poetik-Vorlesungen erschienen, die der evangelische Theologe und Lyriker Christian Lehnert im Sommersemester 2022 in Wien gehalten hat. In diesen Vorlesungen wird die Sprache verstanden als Übergang zwischen Hier und Dort und ist demzufolge ein über sich hinausweisendes, zwangsläufig mangelhaftes Hilfsmittel, um das Unbekannte zu sondieren. Es ist dieses Sprachverständnis, das für Lehnert die Sprache der Religion mit der Sprache der Poesie verbindet. Beide Sprachformen lassen sich verstehen als „viatorisches“, also „pilgerndes Sprechen“ im Übergang.
LOGBUCH XLVII (22. Mai 2023). Von Beate Broßmann
Es steckt viel Gegenwart und viel inspirierendes Gedankengut in Helmut Lethens neuem Buch über den Großinquisitor, auch wenn der Untertitel vielleicht zunächst falsche Erwartungen weckt. Dieser Schatz will gehoben werden. Die ausführliche Rezension zeigt, wie das gehen könnte.
Es steckt viel Gegenwart und viel inspirierendes Gedankengut in Helmut Lethens neuem Buch über den Großinquisitor, auch wenn der Untertitel vielleicht zunächst falsche Erwartungen weckt. Dieser Schatz will gehoben werden. Die ausführliche Rezension zeigt, wie das gehen könnte.
LOGBUCH XLVI (1. Mai 2023). Von Till Kinzel
Das kulturelle Gedächtnis ist oft ungerecht. Schriftsteller, Künstler und Denker, die es nicht verdient haben, werden vergessen, obwohl sie über ihre Zeit hinaus Impulse vermitteln könnten. So auch im Falle des im Jahre 1921 aus Ungarn gebürtigen Philosophen Thomas (Tamás) Molnar, dessen 100. Geburtstag weitgehend unbeachtet blieb. Glücklicherweise haben sich zwei junge Philosophen, Jan Bentz und Jochen Prinz, an Molnar erinnert. Erstmals wird in ihrem Buch ausführlich der Kern von Molnars Denkens herausgeschält und in philosophischer, politischer, theologischer sowie metaphysischer Hinsicht erörtert.
Das kulturelle Gedächtnis ist oft ungerecht. Schriftsteller, Künstler und Denker, die es nicht verdient haben, werden vergessen, obwohl sie über ihre Zeit hinaus Impulse vermitteln könnten. So auch im Falle des im Jahre 1921 aus Ungarn gebürtigen Philosophen Thomas (Tamás) Molnar, dessen 100. Geburtstag weitgehend unbeachtet blieb. Glücklicherweise haben sich zwei junge Philosophen, Jan Bentz und Jochen Prinz, an Molnar erinnert. Erstmals wird in ihrem Buch ausführlich der Kern von Molnars Denkens herausgeschält und in philosophischer, politischer, theologischer sowie metaphysischer Hinsicht erörtert.
LOGBUCH XLV (10. April 2023). Von Norbert Feinendegen
Der bedeutende Philosoph und Laientheologe C. S. Lewis sah die Dreieinigkeit Gottes als notwendige Konsequenz der Tatsache, daß Gott Liebe ist, wie es im ersten Johannesbrief heißt. In Lewis’ eigenen Worten: „Die Worte ‚Gott ist Liebe‘ haben keine wirkliche Bedeutung, solange Gott nicht mindestens zwei Personen umfaßt. Liebe ist etwas, das eine Person für eine andere Person empfindet. Wäre Gott eine einzige Person, so wäre er vor der Erschaffung der Welt nicht Liebe gewesen.“
Der bedeutende Philosoph und Laientheologe C. S. Lewis sah die Dreieinigkeit Gottes als notwendige Konsequenz der Tatsache, daß Gott Liebe ist, wie es im ersten Johannesbrief heißt. In Lewis’ eigenen Worten: „Die Worte ‚Gott ist Liebe‘ haben keine wirkliche Bedeutung, solange Gott nicht mindestens zwei Personen umfaßt. Liebe ist etwas, das eine Person für eine andere Person empfindet. Wäre Gott eine einzige Person, so wäre er vor der Erschaffung der Welt nicht Liebe gewesen.“
LOGBUCH XLIV (3. April 2023). Von Daniel Zöllner
Im Abendland geht der lebendige Bezug auf die heilige Überlieferung mehr und mehr verloren. Dem abendländischen Denken droht ein Sterilwerden, indem die Vernunft sich abschneidet von dem befruchtenden Einfluß der Offenbarung, die in der heiligen Überlieferung weitergegeben wird. Das abendländische Denken hat nur dann eine Zukunft, wenn es sich – in stetiger Rückbesinnung auf die Tradition, besonders auf die heilige Überlieferung des Christentums – radikal erneuert. Als Keim zu einer radikalen Erneuerung betrachtet der Beitrag das Projekt einer trinitarischen Ontologie.
Im Abendland geht der lebendige Bezug auf die heilige Überlieferung mehr und mehr verloren. Dem abendländischen Denken droht ein Sterilwerden, indem die Vernunft sich abschneidet von dem befruchtenden Einfluß der Offenbarung, die in der heiligen Überlieferung weitergegeben wird. Das abendländische Denken hat nur dann eine Zukunft, wenn es sich – in stetiger Rückbesinnung auf die Tradition, besonders auf die heilige Überlieferung des Christentums – radikal erneuert. Als Keim zu einer radikalen Erneuerung betrachtet der Beitrag das Projekt einer trinitarischen Ontologie.
LOGBUCH XLIII (29. März 2023). Von Michael Rieger
Wie armselig ist die geistige Debatte in diesem Land geworden? Harry Nutt kommt das große Verdienst zu, diesem geistigen Verfall, dieser Unsäglichkeit deutlich und unmißverständlich widersprochen zu haben, und zwar in der Frankfurter Rundschau vom gestrigen Dienstag, den 28. März 2023. Dort kann jeder, den es angeht, einer genauen Schilderung eines Dramas schierer Dummheit beiwohnen. Eine Entrüstung.
Wie armselig ist die geistige Debatte in diesem Land geworden? Harry Nutt kommt das große Verdienst zu, diesem geistigen Verfall, dieser Unsäglichkeit deutlich und unmißverständlich widersprochen zu haben, und zwar in der Frankfurter Rundschau vom gestrigen Dienstag, den 28. März 2023. Dort kann jeder, den es angeht, einer genauen Schilderung eines Dramas schierer Dummheit beiwohnen. Eine Entrüstung.
LOGBUCH XLII (13. März 2023). Von Michael Rieger
Manchmal steckt der Teufel im Detail. Was sagt es über die Sprachpraxis der Gegenwart aus, wenn – ausgerechnet in den Erklärungen der ehrenwerten Elberfelder Bibel – Petrus als „Teamleiter seiner Jünger“ bezeichnet wird? Kann man auf diesen Stein noch etwas bauen? Und wird dadurch nicht gewissermaßen das Ganze fragwürdig? Eine sprach- und kulturkritische Glosse, die den Leser erheitern und zugleich bedenklich stimmen kann.
Manchmal steckt der Teufel im Detail. Was sagt es über die Sprachpraxis der Gegenwart aus, wenn – ausgerechnet in den Erklärungen der ehrenwerten Elberfelder Bibel – Petrus als „Teamleiter seiner Jünger“ bezeichnet wird? Kann man auf diesen Stein noch etwas bauen? Und wird dadurch nicht gewissermaßen das Ganze fragwürdig? Eine sprach- und kulturkritische Glosse, die den Leser erheitern und zugleich bedenklich stimmen kann.
LOGBUCH XLI (25. Februar 2023). Von Christoph Rohde
Wie könnte eine Strategie aussehen, um den Ukraine-Konflikt einzudämmen oder sogar zu beenden? Ein Vorschlag in sieben Punkten aus der Perspektive eines christlichen Realismus, der von Zynismus ebenso weit entfernt ist wie von einem moralistisch-überheblichen Idealismus.
Wie könnte eine Strategie aussehen, um den Ukraine-Konflikt einzudämmen oder sogar zu beenden? Ein Vorschlag in sieben Punkten aus der Perspektive eines christlichen Realismus, der von Zynismus ebenso weit entfernt ist wie von einem moralistisch-überheblichen Idealismus.
LOGBUCH XL (24. Februar 2023). Von Christoph Rohde
Zum Jahrestag von Rußlands Überfall auf die Ukraine läßt sich feststellen, daß sich der Krieg verstetigt hat. Rußland ist es nicht gelungen, die Ukraine im Handstreich zu erobern. Im Gegenteil: durch strategische Fehleinschätzungen, mangelnde Moral und unzureichende militärische und logistische Ausrüstung hat sich die selbsternannte Großmacht in eine prekäre Situation manövriert.
Zum Jahrestag von Rußlands Überfall auf die Ukraine läßt sich feststellen, daß sich der Krieg verstetigt hat. Rußland ist es nicht gelungen, die Ukraine im Handstreich zu erobern. Im Gegenteil: durch strategische Fehleinschätzungen, mangelnde Moral und unzureichende militärische und logistische Ausrüstung hat sich die selbsternannte Großmacht in eine prekäre Situation manövriert.
LOGBUCH XXXIX (6. Februar 2023). Von Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
Im Transhumanismus versucht der Mensch Gott nachzuäffen. Doch es gibt auch eine genuin christliche Vergöttlichung des Menschen, ja diese Idee führt sogar in den Glutkern des christlichen Glaubens. Im 20. Jahrhundert hat dies insbesondere Romano Guardini gesehen, auf dessen Aussagen sich der Beitrag stützt. So wird ein gläubiges Gegenmodell zu den transhumanistischen Verirrungen und Versuchungen entworfen.
Im Transhumanismus versucht der Mensch Gott nachzuäffen. Doch es gibt auch eine genuin christliche Vergöttlichung des Menschen, ja diese Idee führt sogar in den Glutkern des christlichen Glaubens. Im 20. Jahrhundert hat dies insbesondere Romano Guardini gesehen, auf dessen Aussagen sich der Beitrag stützt. So wird ein gläubiges Gegenmodell zu den transhumanistischen Verirrungen und Versuchungen entworfen.
LOGBUCH XXXVIII (16. Januar 2023). Von Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
Wir stehen heute in der Brandung des „Fortschritts“, uns selbst konstruieren zu können. Transhumanismus setzt auf die Mechanik des Körpers, die sich nachbauen, mehr noch: verbessern, steigern, ja ersetzen läßt. Der Wunsch nach „übermenschlichem Dasein“ tastet sich in die Möglichkeit hinein, die körperlichen und reflexiven Grenzen des Menschen technologisch zu weiten, sie sogar zu sprengen – in unbekanntes Neuland des Könnens und Machens einzutreten. Utopien im Sinne des totalen Selbstentwurfs setzen sich zunehmend durch.
Wir stehen heute in der Brandung des „Fortschritts“, uns selbst konstruieren zu können. Transhumanismus setzt auf die Mechanik des Körpers, die sich nachbauen, mehr noch: verbessern, steigern, ja ersetzen läßt. Der Wunsch nach „übermenschlichem Dasein“ tastet sich in die Möglichkeit hinein, die körperlichen und reflexiven Grenzen des Menschen technologisch zu weiten, sie sogar zu sprengen – in unbekanntes Neuland des Könnens und Machens einzutreten. Utopien im Sinne des totalen Selbstentwurfs setzen sich zunehmend durch.