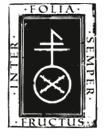LOGBUCH LXXIV (15. Juni 2025). Von Uwe Wolff
Heinrich Maria Janssen (1907–1988) war ein sehr beliebter und volkstümlicher Bischof. Lebte er heute, so wäre er gewiß ein entschiedener Förderer des synodalen Weges. Doch Janssen soll als Bischof von Hildesheim zwischen 1958 und 1963 einen Ministranten jahrelang sexuell mißbraucht haben. Diesen Fall nimmt Wolff zum Anlaß, grundsätzlich über Schuld und Strafe, das Böse und die Verdammnis nachzudenken, gerade vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Verdrängung dieser Themen.
Heinrich Maria Janssen (1907–1988) war ein sehr beliebter und volkstümlicher Bischof. Lebte er heute, so wäre er gewiß ein entschiedener Förderer des synodalen Weges. Doch Janssen soll als Bischof von Hildesheim zwischen 1958 und 1963 einen Ministranten jahrelang sexuell mißbraucht haben. Diesen Fall nimmt Wolff zum Anlaß, grundsätzlich über Schuld und Strafe, das Böse und die Verdammnis nachzudenken, gerade vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Verdrängung dieser Themen.
LOGBUCH LXXIII (15. Mai 2025). Von Daniel Zöllner
Der dänische Schriftsteller Søren Kierkegaard hat sein großes Werk im wesentlichen in den zwölf Jahren zwischen 1843 und seinem Tod im Jahre 1855 geschaffen. In diesem einzigartigen Werk nimmt die Schrift „Die Krankheit zum Tode“ (1849) eine zentrale Stellung ein. Romano Guardini schreibt, „Die Krankheit zum Tode“ scheine „der eigentliche Schlüssel zu Kierkegaards Schaffen“ zu sein. Eine neuere Publikation von Moritz René Pretzsch thematisiert anhand dieser Schrift die Grundstimmungen im Schaffen Kierkegaards.
Der dänische Schriftsteller Søren Kierkegaard hat sein großes Werk im wesentlichen in den zwölf Jahren zwischen 1843 und seinem Tod im Jahre 1855 geschaffen. In diesem einzigartigen Werk nimmt die Schrift „Die Krankheit zum Tode“ (1849) eine zentrale Stellung ein. Romano Guardini schreibt, „Die Krankheit zum Tode“ scheine „der eigentliche Schlüssel zu Kierkegaards Schaffen“ zu sein. Eine neuere Publikation von Moritz René Pretzsch thematisiert anhand dieser Schrift die Grundstimmungen im Schaffen Kierkegaards.
LOGBUCH LXXII (15. April 2025). Von Norbert Feinendegen
Es gibt wohl kaum einen Aspekt der christlichen Theologie, der heute weniger populär ist als die Lehre von der Hölle. Ist es nicht unerträglich, annehmen zu müssen, ein liebender Gott schließe einen Teil seiner Geschöpfe aufgrund ihrer temporären irdischen Verfehlungen von der Teilhabe an der ewigen himmlischen Herrlichkeit aus? Ist ein Gott, der den Gehorsam seiner Geschöpfe gegenüber seinen Geboten dadurch erzwingt, daß er ihnen bei Nichtbefolgung mit der ewigen Verdammnis droht, nicht ethisch völlig inakzeptabel? Der große christliche Denker C. S. Lewis hat eigene Antworten auf diese Fragen gegeben.
Es gibt wohl kaum einen Aspekt der christlichen Theologie, der heute weniger populär ist als die Lehre von der Hölle. Ist es nicht unerträglich, annehmen zu müssen, ein liebender Gott schließe einen Teil seiner Geschöpfe aufgrund ihrer temporären irdischen Verfehlungen von der Teilhabe an der ewigen himmlischen Herrlichkeit aus? Ist ein Gott, der den Gehorsam seiner Geschöpfe gegenüber seinen Geboten dadurch erzwingt, daß er ihnen bei Nichtbefolgung mit der ewigen Verdammnis droht, nicht ethisch völlig inakzeptabel? Der große christliche Denker C. S. Lewis hat eigene Antworten auf diese Fragen gegeben.
LOGBUCH LXXI (16. März 2025). Von Martin Thoms
Wird es am Ende Gerechtigkeit geben? Und wie wird sie aussehen? Ausgehend von diesen Fragen gelangt Thoms zu seiner Auffassung des Fegefeuers und zu der These: Das Fegefeuer ist keine angsteinflößende Drohbotschaft vom Heil weniger, sondern die allerlösende Frohbotschaft einer allversöhnten und geläuterten Menschheit.
Wird es am Ende Gerechtigkeit geben? Und wie wird sie aussehen? Ausgehend von diesen Fragen gelangt Thoms zu seiner Auffassung des Fegefeuers und zu der These: Das Fegefeuer ist keine angsteinflößende Drohbotschaft vom Heil weniger, sondern die allerlösende Frohbotschaft einer allversöhnten und geläuterten Menschheit.
LOGBUCH LXX (18. Februar 2025). Von Christoph Rohde
US-Präsident Donald Trump forciert seit seinem Amtsantritt Verhandlungen, die auf ein Ende des Ukraine-Krieges zielen sollen. Er akzeptiert dabei prinzipiell ein russisches Sicherheitsvorfeld, indem er den NATO-Beitritt der Ukraine in weite Ferne rückt und von beiden Kriegsparteien Konzessionen fordert. Mit seinem Ansatz bestätigt er das Großmachtdenken realistischer Staatsmänner von Metternich über Bismarck bis Kissinger. Ob seine Bemühungen zu einem Waffenstillstand führen, ist jedoch noch offen.
US-Präsident Donald Trump forciert seit seinem Amtsantritt Verhandlungen, die auf ein Ende des Ukraine-Krieges zielen sollen. Er akzeptiert dabei prinzipiell ein russisches Sicherheitsvorfeld, indem er den NATO-Beitritt der Ukraine in weite Ferne rückt und von beiden Kriegsparteien Konzessionen fordert. Mit seinem Ansatz bestätigt er das Großmachtdenken realistischer Staatsmänner von Metternich über Bismarck bis Kissinger. Ob seine Bemühungen zu einem Waffenstillstand führen, ist jedoch noch offen.
LOGBUCH LXIX (15. Januar 2025). Von Christoph Fackelmann
Der künstlerische Reichtum, den die Hinwendung der Deutschen Romantik zum Märchen hervorbrachte, ist staunenswert, und die Vitalität, mit der sie an dem wohleingerichteten und gutgesicherten Wahrheitssystem des rationalistischen Domestizierungsprojektes rüttelt, wirkt zeitenüberdauernd. Auch daß sie sich der Dämonie, die sich dabei auftut und mitunter ausgesprochen homunkuleisch-hybride Züge aufweist, stellt, macht ihre Bedeutung aus.
Der künstlerische Reichtum, den die Hinwendung der Deutschen Romantik zum Märchen hervorbrachte, ist staunenswert, und die Vitalität, mit der sie an dem wohleingerichteten und gutgesicherten Wahrheitssystem des rationalistischen Domestizierungsprojektes rüttelt, wirkt zeitenüberdauernd. Auch daß sie sich der Dämonie, die sich dabei auftut und mitunter ausgesprochen homunkuleisch-hybride Züge aufweist, stellt, macht ihre Bedeutung aus.
LOGBUCH LXVIII (20. Dezember 2024). Von Daniel Zöllner
Philipp Theisohn, Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Zürich, nähert sich Botho Strauß – der Person und vor allem dem Werk – in einem neu erschienenen Buch unter dem Titel „Denken nach Botho Strauß. Begegnungen in einer anderen Zeit“. Es gehe Strauß beim Schreiben um das Durchbrechen des Gedränges der „sekundären Stadt“ (George Steiner). Dieses Anliegen scheint Theisohn wichtiger und ursprünglicher als die bis zur Erschöpfung diskutierten politischen Facetten von Strauß’ berühmtestem Essay „Anschwellender Bocksgesang“ von 1993.
Philipp Theisohn, Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Zürich, nähert sich Botho Strauß – der Person und vor allem dem Werk – in einem neu erschienenen Buch unter dem Titel „Denken nach Botho Strauß. Begegnungen in einer anderen Zeit“. Es gehe Strauß beim Schreiben um das Durchbrechen des Gedränges der „sekundären Stadt“ (George Steiner). Dieses Anliegen scheint Theisohn wichtiger und ursprünglicher als die bis zur Erschöpfung diskutierten politischen Facetten von Strauß’ berühmtestem Essay „Anschwellender Bocksgesang“ von 1993.
LOGBUCH LXVII (2. Dezember 2024). Von Beate Broßmann
Eine Ikone feiert heute ihren 80. Geburtstag – und hat kurz davor ihren Lesern ein Geschenk gemacht: „Das Schattengetuschel“, erschienen im Oktober im Hanser-Verlag. Aus diesem Anlaß hat unsere Autorin einen Text verfaßt, der nicht so sehr Buchkritik, Rezension ist als vielmehr die begeisterte, aber zuweilen auch ratlose Antwort eines Lesers – und zugleich eine Hommage an einen großen Autor.
Eine Ikone feiert heute ihren 80. Geburtstag – und hat kurz davor ihren Lesern ein Geschenk gemacht: „Das Schattengetuschel“, erschienen im Oktober im Hanser-Verlag. Aus diesem Anlaß hat unsere Autorin einen Text verfaßt, der nicht so sehr Buchkritik, Rezension ist als vielmehr die begeisterte, aber zuweilen auch ratlose Antwort eines Lesers – und zugleich eine Hommage an einen großen Autor.
LOGBUCH LXVI (15. November 2024). Von Ruth Wahlster
Passend zum hundertjährigen Jubiläum ihres Erscheinens bildeten le Forts „Hymnen an die Kirche“ einen Schwerpunkt der diesjährigen Jahrestagung der Gertrud von le Fort-Gesellschaft, die vom 6. bis 8. September unter dem Thema „Kirche bei Gertrud von le Fort: Hort der Ordnung – Hort der Barmherzigkeit“ in das schöne und hoch über der Stadt Passau gelegene Exerzitien- und Bildungshaus auf Mariahilf einlud. Ein Tagungsbericht.
Passend zum hundertjährigen Jubiläum ihres Erscheinens bildeten le Forts „Hymnen an die Kirche“ einen Schwerpunkt der diesjährigen Jahrestagung der Gertrud von le Fort-Gesellschaft, die vom 6. bis 8. September unter dem Thema „Kirche bei Gertrud von le Fort: Hort der Ordnung – Hort der Barmherzigkeit“ in das schöne und hoch über der Stadt Passau gelegene Exerzitien- und Bildungshaus auf Mariahilf einlud. Ein Tagungsbericht.
LOGBUCH LXV (16. Oktober 2024). Von Franz Prosinger
In seiner Antwort auf den letzten LOGBUCH-Beitrag widerspricht Prosinger Martin Thoms: Die dialogische Beziehung zwischen Gott und Mensch wahrt die souveräne Eigenständigkeit der göttlichen und die anvertraute Eigenständigkeit der menschlichen Person. Die Immanenz Gottes, seine Shekinah, ist der Abglanz seiner Transzendenz (vgl. Weish 7,26; Heb 1,3) und kein „gottverlassener Gott“.
In seiner Antwort auf den letzten LOGBUCH-Beitrag widerspricht Prosinger Martin Thoms: Die dialogische Beziehung zwischen Gott und Mensch wahrt die souveräne Eigenständigkeit der göttlichen und die anvertraute Eigenständigkeit der menschlichen Person. Die Immanenz Gottes, seine Shekinah, ist der Abglanz seiner Transzendenz (vgl. Weish 7,26; Heb 1,3) und kein „gottverlassener Gott“.
LOGBUCH LXIV (13. September 2024). Von Martin Thoms
Wo ist Gott? Diese Frage erschallt durch die Menschheitsgeschichte. Wo ist Gott in Zeiten der Flüchtlings-, Klima- und Coronakrise? Wo ist Gott in Zeiten von Krieg und persönlichen Krisen? Wo ist Gott, wenn Kinder im Gazastreifen in die Luft gesprengt werden? Wo ist Gott, wenn in der Ukraine massenhaft unschuldige Menschen sterben? Wo ist Gott, wenn mein Gebet nicht erhört, die Krankheit nicht geheilt wird, das Leben keine gute Wendung nimmt? Ist diese Welt wirklich gottlos? Und wo ist Gott in dieser (scheinbar) gottverlassenen Welt? Wie können wir von Gott sprechen angesichts des Leids und der seufzenden Kreatur?
Wo ist Gott? Diese Frage erschallt durch die Menschheitsgeschichte. Wo ist Gott in Zeiten der Flüchtlings-, Klima- und Coronakrise? Wo ist Gott in Zeiten von Krieg und persönlichen Krisen? Wo ist Gott, wenn Kinder im Gazastreifen in die Luft gesprengt werden? Wo ist Gott, wenn in der Ukraine massenhaft unschuldige Menschen sterben? Wo ist Gott, wenn mein Gebet nicht erhört, die Krankheit nicht geheilt wird, das Leben keine gute Wendung nimmt? Ist diese Welt wirklich gottlos? Und wo ist Gott in dieser (scheinbar) gottverlassenen Welt? Wie können wir von Gott sprechen angesichts des Leids und der seufzenden Kreatur?
LOGBUCH LXIII (18. August 2024). Von Daniel Zöllner
Klaus Heinrich (1927–2020) war Professor für Religionswissenschaft auf religionsphilosophischer Grundlage an der Freien Universität Berlin. Seine Habilitation erfolgte mit dem Aufsatzband „Parmenides und Jona. Vier Studien über das Verhältnis von Philosophie und Mythologie“ sowie mit der Schrift „Versuch über die Schwierigkeit nein zu sagen“, die 1964 bei Suhrkamp erschien. Daß sich eine Auseinandersetzung mit diesem im wahrsten Sinne des Wortes außergewöhnlichen Werk auch weiterhin lohnt, zeigt der vorliegende Beitrag.
Klaus Heinrich (1927–2020) war Professor für Religionswissenschaft auf religionsphilosophischer Grundlage an der Freien Universität Berlin. Seine Habilitation erfolgte mit dem Aufsatzband „Parmenides und Jona. Vier Studien über das Verhältnis von Philosophie und Mythologie“ sowie mit der Schrift „Versuch über die Schwierigkeit nein zu sagen“, die 1964 bei Suhrkamp erschien. Daß sich eine Auseinandersetzung mit diesem im wahrsten Sinne des Wortes außergewöhnlichen Werk auch weiterhin lohnt, zeigt der vorliegende Beitrag.