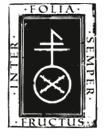LOGBUCH LXVIII (20. Dezember 2024). Von Daniel Zöllner
Philipp Theisohn ist Professor für Literaturwissenschaft, und er nähert sich Botho Strauß – der Person und vor allem dem Werk – im Bewußtsein der Gefahren, die sein Fach mit sich bringt. Gehört es nicht geradezu zum Wesen der literaturwissenschaftlichen Forschung, daß sie sich der Produktion von Sekundär- und Tertiärdiskursen verschreibt? Daß sie Gefahr läuft, die Erfahrung des literarischen Kunstwerks mit Interpretationen zu verdecken und im schlimmsten Fall sogar zu verbauen? Es zeichnet Theisohns Buch aus, daß der Autor sich dieser Gefahren bewußt ist.
1990 erschien Strauß’ Essay „Der Aufstand gegen die sekundäre Welt. Bemerkungen zu einer Ästhetik der Anwesenheit“ als Nachwort zur deutschen Übersetzung von George Steiners Real Presences. Dazu bemerkt Theisohn: „Für einen Literaturwissenschaftler, der sich aus freien Stücken dafür entschieden hatte, sein Leben dem Sekundären zu unterstellen, nahm sich die Lektüre dieses Nachworts natürlich zunächst einmal als eine Lektion in Selbstverachtung aus.“ (13)
Theisohn erklärt Strauß’ „Aufstand gegen die sekundäre Welt“ zum Ausgangspunkt seines Nachdenkens. Es gehe Strauß beim Schreiben um das Durchbrechen des Gedränges der „sekundären Stadt“ (George Steiner). Dieses Anliegen scheint Theisohn wichtiger und ursprünglicher als die bis zur Erschöpfung diskutierten politischen Facetten von Strauß’ berühmtestem Essay „Anschwellender Bocksgesang“ von 1993.
Immer wieder bemerkt Theisohn, daß die primäre Erfahrung durch Lektüre nicht nur befreit und gesteigert, sondern manchmal eben auch eingeschränkt wird. Theisohn schreibt sogar von seiner eigenen „literarische[n] Vergiftung“ (54). Die Gefahr der „Vergiftung“ ist dem Wesen der Schriftlichkeit eingeschrieben, denn die Schrift ist Medium, sekundär gegenüber Erfahrung und Stimme, und „[w]er schreibt, der steht immer schon im Ruch, ein Kollaborateur zu sein, ein Agent der Abstraktion und der großen Pläne. Schrift verführt zur klaren Linie, zur Aufhebung des zufällig Benachbarten, aber doch gänzlich Verschiedenem im höheren Gedanken.“ (30)
Es liegt auf der Hand, daß ein Schreiben, das das Gedränge der „sekundären Stadt“ durchbrechen will, von besonderer Art sein muß. Theisohn zeigt an Straußschen Texten wie Beginnlosigkeit. Reflexionen über Fleck und Linie, dem berühmten Paare, Passanten sowie dem Roman Der junge Mann, wie Strauß’ Schreiben der „sekundären Stadt“ sowie der linear gedachten Zeit zu entfliehen sucht. Die „andere Zeit“, von der schon der Titel von Theisohns Buch spricht und die Strauß im Schreiben anvisiere, sei nicht durch eine „Flucht in eine graue oder goldene Vorzeit“ (26) zu erreichen, sondern durch den Abschied vom Zeitpfeil, der Erinnerung und Teleologie aneinanderknüpft. Der Durchbruch aus dem Gedränge der „sekundären Stadt“ geschieht als Blitz, der „den Spiegel zum Bersten“ bringt, wie Strauß in „Der Aufstand gegen die sekundäre Welt“ formuliert. Mit Strauß könne man, so Theisohn, sogar feststellen, daß die Sprache generell „Flucht“ sei, „weil für das, was sich uns im Schweigen zeigt, keine Worte mehr sind.“ (46) Aber gerade um das, was sich uns im Schweigen zeigt, geht es Strauß – nicht anders als jeder echten Dichtung, die mehr möchte als „informieren“ und „kommunizieren“. Man könne bei Strauß lernen, „wie viel Klarheit möglich ist.“ (124)
Es liegt in der Konsequenz von Theisohns erklärter „Selbstverachtung“ als Literaturwissenschaftler, daß sein Strauß-Essay nicht nur Sekundärdiskurs, sondern auch erzählerische Passagen enthält. So wird ausführlich von einem Besuch des Autors bei Strauß in der Uckermark berichtet (vgl. 47–64). Es ist Theisohn hoch anzurechnen, daß er seine Subjektivität nicht ausklammert.
Auch wenn Theisohn sich in der zweiten Hälfte seines Buches der Auslegung der stets in den geschichtlichen Zeitkontext eingeordneten Theaterstücke von Botho Strauß zuwendet, geht er behutsam vor. Die Stücke Schlußchor (1991), Trilogie des Wiedersehens (1977) sowie Kalldewey, Farce (1982) werden ausführlich besprochen. Dabei wird deutlich, wie das Theater noch stärker als die Prosa an politische Umstände gebunden ist, sich darin spiegelt, findet oder auch dadurch unmöglich gemacht wird. Das Theaterstück Groß und klein (1978) wird vor allem anhand der Figur der Lotte thematisiert, die beispielhaft von Edith Clever verkörpert worden ist. Theisohn erzählt auch von einem Treffen mit dieser berühmten Schauspielerin.
Angesichts von Kalldewey, Farce konstatiert Theisohn: „Die Vermengung von kulturbürgerlichem Gestus und Warenästhetik“ sei „nicht nur die historische Außenseite, sondern auch programmatischer Kern dieser Dramatik.“ (91) Theisohn denkt über die damit verknüpfte Frage nach, ob Strauß’ Dramatik untrennbar mit der Zeit verbunden ist, in der sie entstand. Der Titel von Theisohns Buch, „Denken nach Botho Strauß“, scheint ja die Andeutung zu enthalten, daß Strauß bereits der Vergangenheit angehöre, daß wir uns in einem Zeitraum nach ihm befänden – was sich ja auch daran zeigt, daß die Straußschen Stücke nur noch selten inszeniert werden. Das schließt ja nicht aus, daß uns das Werk von Strauß immer noch viel Stoff zum Nachdenken liefert – das Buch von Theisohn ist wohl der beste Beleg dafür.
Theisohns Buch ist voraussetzungs- und anspielungsreich. Fast möchte man diejenigen vor der Lektüre warnen, die nicht mit der literarischen Bildung Theisohns ausgestattet sind. Es besteht die Gefahr einer Enttäuschung. Und doch wird man auch dann immer wieder mit Einsichten belohnt, wenn man nicht jeden Gedanken im Detail nachvollziehen kann oder wenn man – wie übrigens auch der Rezensent – vom Straußschen Werk bisher nur wenig zur Kenntnis genommen hat. Deutlich wird auf jeden Fall, daß sich eine weitere Auseinandersetzung mit dem Werk Strauß’ lohnt, weil es dem Leser Erkenntnis- und nicht zuletzt auch Lustgewinn verspricht.
Abbildung: Mathias Reding, pexels.com