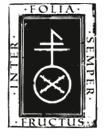LOGBUCH LXXXV (26. Januar 2026). Von Daniel Zöllner
Das neue Buch von Sebastian Ostritsch spricht über ein Kernthema der sogenannten natürlichen Theologie: die Argumente für die Existenz Gottes, die sich allein mithilfe der Vernunft gewinnen lassen. Indem Ostritsch den Gegenargumenten Kants und anderer moderner Philosophen immer wieder Raum gibt, kann sein Buch den Anspruch erheben, nach dem Zeitalter der Aufklärung die natürliche Theologie auf ein neues Fundament zu stellen – oder zumindest eine Erneuerung des scholastischen Projektes anzustoßen.
Das neue Buch von Sebastian Ostritsch spricht über ein Kernthema der sogenannten natürlichen Theologie: die Argumente für die Existenz Gottes, die sich allein mithilfe der Vernunft gewinnen lassen. Indem Ostritsch den Gegenargumenten Kants und anderer moderner Philosophen immer wieder Raum gibt, kann sein Buch den Anspruch erheben, nach dem Zeitalter der Aufklärung die natürliche Theologie auf ein neues Fundament zu stellen – oder zumindest eine Erneuerung des scholastischen Projektes anzustoßen.
LOGBUCH LXXXIV (12. Januar 2026). Von Sascha Vetterle
Die ganzheitliche Ökologie von Papst Franziskus ist ein fruchtbarer Ansatz, auf das zu blicken, was lebensförderlich und was schädlich für das Leben ist, und hierbei die vielfältigen Interdependenzen zu berücksichtigen. Statt eines technokratischen „Wie“ stellt sie das naturrechtliche „Wozu“ in den Fokus. In letzter Konsequenz geht es dabei um den Aufbau einer ganzheitlichen Kultur des Lebens.
Die ganzheitliche Ökologie von Papst Franziskus ist ein fruchtbarer Ansatz, auf das zu blicken, was lebensförderlich und was schädlich für das Leben ist, und hierbei die vielfältigen Interdependenzen zu berücksichtigen. Statt eines technokratischen „Wie“ stellt sie das naturrechtliche „Wozu“ in den Fokus. In letzter Konsequenz geht es dabei um den Aufbau einer ganzheitlichen Kultur des Lebens.
LOGBUCH LXXXIII (25. Dezember 2025). Von Franz Prosinger
Heute begehen wir das Fest der Geburt des Erlösers aus der Jungfrau Maria. Aus diesem Anlaß denkt unser Autor über das vatikanische Dokument „Mater populi fidelis“ nach, das am 4. November 2025 vom Dikasterium für die Glaubenslehre veröffentlicht wurde. Es stellt sich die Frage, ob und inwieweit man Maria als „Miterlöserin“ bezeichnen kann oder ob dies eher für Mißverständnisse sorgt.
Heute begehen wir das Fest der Geburt des Erlösers aus der Jungfrau Maria. Aus diesem Anlaß denkt unser Autor über das vatikanische Dokument „Mater populi fidelis“ nach, das am 4. November 2025 vom Dikasterium für die Glaubenslehre veröffentlicht wurde. Es stellt sich die Frage, ob und inwieweit man Maria als „Miterlöserin“ bezeichnen kann oder ob dies eher für Mißverständnisse sorgt.
LOGBUCH LXXXII (4. Dezember 2025). Von Daniel Zöllner
Wenn ein Autor, der sich selbst als „Engelforscher“ versteht, eine Rilke-Biographie schreibt, dann ist ein Werk zu erwarten, das die Konventionen des Genres sprengt. Denn die Engel sind nun einmal Wesen, die das Menschliche und Irdische sprengen und übersteigen. Und tatsächlich ist ein Buch entstanden, das zwar nicht den Anspruch einer „vollständigen“ Biographie und Werkinterpretation erheben kann, sich dafür aber in erhellender Weise dem Unsagbaren nähert, das für Rilke in Leben und Dichten die Engel verkörperten. Ein Beitrag zum 150. Geburtstag des Dichters.
Wenn ein Autor, der sich selbst als „Engelforscher“ versteht, eine Rilke-Biographie schreibt, dann ist ein Werk zu erwarten, das die Konventionen des Genres sprengt. Denn die Engel sind nun einmal Wesen, die das Menschliche und Irdische sprengen und übersteigen. Und tatsächlich ist ein Buch entstanden, das zwar nicht den Anspruch einer „vollständigen“ Biographie und Werkinterpretation erheben kann, sich dafür aber in erhellender Weise dem Unsagbaren nähert, das für Rilke in Leben und Dichten die Engel verkörperten. Ein Beitrag zum 150. Geburtstag des Dichters.
LOGBUCH LXXXI (24. November 2025). Von Gudrun Trausmuth
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz und Michael Wladika legten in der ersten Jahreshälfte 2025 den Pilotband der neuen Reihe „Guardini-Studien“ im Herder-Verlag vor. Das ambitionierte akademische Projekt der Katholischen Hochschule Trumau soll in zwei Bänden pro Jahr Perspektiven auf Guardinis Werk eröffnen und die Aktualität des 1885 in Verona geborenen und 1968 in München verstorbenen Theologen deutlich machen.
Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz und Michael Wladika legten in der ersten Jahreshälfte 2025 den Pilotband der neuen Reihe „Guardini-Studien“ im Herder-Verlag vor. Das ambitionierte akademische Projekt der Katholischen Hochschule Trumau soll in zwei Bänden pro Jahr Perspektiven auf Guardinis Werk eröffnen und die Aktualität des 1885 in Verona geborenen und 1968 in München verstorbenen Theologen deutlich machen.
LOGBUCH LXXX (14. November 2025). Von Uwe Wolff
Jean Paul (1763–1825) ist der Dichter der Freundschaft, der Liebe und der Engel. In keinem Werk der deutschen Literatur wuseln die Boten des Himmels mehr herum als in den Erzählungen und Romanen des Pastorensohnes aus Wunsiedel. Eine Liebeserklärung zum 200. Todestag des Dichters.
Jean Paul (1763–1825) ist der Dichter der Freundschaft, der Liebe und der Engel. In keinem Werk der deutschen Literatur wuseln die Boten des Himmels mehr herum als in den Erzählungen und Romanen des Pastorensohnes aus Wunsiedel. Eine Liebeserklärung zum 200. Todestag des Dichters.
LOGBUCH LXXIX (15. Oktober 2025). Von Daniel Zöllner
Gerd-Klaus Kaltenbrunner (1939–2011) hat zu seinen Lebzeiten zwei Trilogien mit Essays über europäische Gestalten publiziert. In seinem Spätwerk hat Kaltenbrunner weitere bedeutende Männer und Frauen aus der Geschichte des Abendlandes essayistisch porträtiert. Diese Essays, die etwa in den Zeitschriften „Theologisches“, „Einsicht“ und „Vobiscum“ erschienen sind, lagen bisher aber noch nicht in Buchform vor. Mit dem kürzlich im Renovamen-Verlag erschienenen Band „Abendland. Geheiligte Kultur, geliebte Heimat“ hat sich das geändert: Die verstreut erschienenen Essays liegen jetzt gesammelt vor, ergänzt um einige Texte aus den älteren Trilogien. Eine Würdigung.
Gerd-Klaus Kaltenbrunner (1939–2011) hat zu seinen Lebzeiten zwei Trilogien mit Essays über europäische Gestalten publiziert. In seinem Spätwerk hat Kaltenbrunner weitere bedeutende Männer und Frauen aus der Geschichte des Abendlandes essayistisch porträtiert. Diese Essays, die etwa in den Zeitschriften „Theologisches“, „Einsicht“ und „Vobiscum“ erschienen sind, lagen bisher aber noch nicht in Buchform vor. Mit dem kürzlich im Renovamen-Verlag erschienenen Band „Abendland. Geheiligte Kultur, geliebte Heimat“ hat sich das geändert: Die verstreut erschienenen Essays liegen jetzt gesammelt vor, ergänzt um einige Texte aus den älteren Trilogien. Eine Würdigung.
LOGBUCH LXXVIII (24. September 2025). Von Michael Rieger
Als Fortsetzung des letzten Beitrags folgen hier zwei weitere „Randnotizen“. Der erste Essay hat die Praxis der Vergangenheit zum Thema, fremdsprachige Operntexte in die Sprache des Publikums zu übersetzen. Wagners „Parsifal“ auf Italienisch? Es ist verständlich, daß derartige Versuche heute nur noch Befremden auslösen. Der zweite Essay nimmt das Musikleben in den USA in den Blick, das in der Vergangenheit ganz wesentlich durch Dirigenten europäischer, besonders ungarischer Herkunft geprägt war und erst durch diese Emigranten das heutige Niveau erreichen konnte.
Als Fortsetzung des letzten Beitrags folgen hier zwei weitere „Randnotizen“. Der erste Essay hat die Praxis der Vergangenheit zum Thema, fremdsprachige Operntexte in die Sprache des Publikums zu übersetzen. Wagners „Parsifal“ auf Italienisch? Es ist verständlich, daß derartige Versuche heute nur noch Befremden auslösen. Der zweite Essay nimmt das Musikleben in den USA in den Blick, das in der Vergangenheit ganz wesentlich durch Dirigenten europäischer, besonders ungarischer Herkunft geprägt war und erst durch diese Emigranten das heutige Niveau erreichen konnte.
LOGBUCH LXXVII (3. September 2025). Von Michael Rieger
Zu den wirklich populären und weit verbreiteten Aufnahmen „klassischer“ Musik zählen gewiß Bachs Goldberg-Variationen in den Klaviereinspielungen von Glenn Gould. Auch die „Klavierkonzerte“ desselben Komponisten hat Gould am Pianoforte aufgenommen. Aber das Klavier, wie wir es heute kennen, steckte zu Bachs Zeiten noch in den Kinderschuhen, der Komponist schrieb eigentlich für das Cembalo. In einem Essay zur Musik- und Interpretationsgeschichte denkt Rieger über die Implikationen dieser Tatsache und über Bachs geistigen Kosmos nach.
Zu den wirklich populären und weit verbreiteten Aufnahmen „klassischer“ Musik zählen gewiß Bachs Goldberg-Variationen in den Klaviereinspielungen von Glenn Gould. Auch die „Klavierkonzerte“ desselben Komponisten hat Gould am Pianoforte aufgenommen. Aber das Klavier, wie wir es heute kennen, steckte zu Bachs Zeiten noch in den Kinderschuhen, der Komponist schrieb eigentlich für das Cembalo. In einem Essay zur Musik- und Interpretationsgeschichte denkt Rieger über die Implikationen dieser Tatsache und über Bachs geistigen Kosmos nach.
LOGBUCH LXXVI (17. August 2025). Von Beate Broßmann
Wieder ein Gemälde, wie in dem Vorgängerroman „Taube und Wildente“. Und erneut die westdeutsche High Society. Auch der traditionelle Erzählstil des Romans, der so gar nicht zu den Verhaltensweisen der dramatis personae passen will, wird vom Autor beibehalten. Der Roman „Die Richtige“ greift das oft in der Kunst verarbeitete Motiv von Maler und Modell auf originelle Art auf. Der Autor greift in die Vollen der deutschen Sprach- und Kulturgeschichte und bedient sich ihres sprachlich-geistigen Höchststands, um die Gegenwart zu beschreiben und noch einmal diejenigen zu beschenken, die sich der tiefen Tragik des Kulturverlustes bewußt sind.
Wieder ein Gemälde, wie in dem Vorgängerroman „Taube und Wildente“. Und erneut die westdeutsche High Society. Auch der traditionelle Erzählstil des Romans, der so gar nicht zu den Verhaltensweisen der dramatis personae passen will, wird vom Autor beibehalten. Der Roman „Die Richtige“ greift das oft in der Kunst verarbeitete Motiv von Maler und Modell auf originelle Art auf. Der Autor greift in die Vollen der deutschen Sprach- und Kulturgeschichte und bedient sich ihres sprachlich-geistigen Höchststands, um die Gegenwart zu beschreiben und noch einmal diejenigen zu beschenken, die sich der tiefen Tragik des Kulturverlustes bewußt sind.
LOGBUCH LXXV (15. Juli 2025). Von Michael Rieger
Ein verstörendes Erlebnis im Straßenverkehr läßt unseren Autor die Frage stellen: Gilt heute nur noch „Homo homini lupus est“? Der Verkehr ist wohl kein schlechtes Sinnbild einer kaputten Gesellschaft – jeder gegen jeden. Wie steht es angesichts dieser allgegenwärtigen Verkommenheit und Verlotterung um die Chancen des Humanismus? Muß dieser begraben werden? Forsetzung eines Essays von 2022.
Ein verstörendes Erlebnis im Straßenverkehr läßt unseren Autor die Frage stellen: Gilt heute nur noch „Homo homini lupus est“? Der Verkehr ist wohl kein schlechtes Sinnbild einer kaputten Gesellschaft – jeder gegen jeden. Wie steht es angesichts dieser allgegenwärtigen Verkommenheit und Verlotterung um die Chancen des Humanismus? Muß dieser begraben werden? Forsetzung eines Essays von 2022.
LOGBUCH LXXIV (15. Juni 2025). Von Uwe Wolff
Heinrich Maria Janssen (1907–1988) war ein sehr beliebter und volkstümlicher Bischof. Lebte er heute, so wäre er gewiß ein entschiedener Förderer des synodalen Weges. Doch Janssen soll als Bischof von Hildesheim zwischen 1958 und 1963 einen Ministranten jahrelang sexuell mißbraucht haben. Diesen Fall nimmt Wolff zum Anlaß, grundsätzlich über Schuld und Strafe, das Böse und die Verdammnis nachzudenken, gerade vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Verdrängung dieser Themen.
Heinrich Maria Janssen (1907–1988) war ein sehr beliebter und volkstümlicher Bischof. Lebte er heute, so wäre er gewiß ein entschiedener Förderer des synodalen Weges. Doch Janssen soll als Bischof von Hildesheim zwischen 1958 und 1963 einen Ministranten jahrelang sexuell mißbraucht haben. Diesen Fall nimmt Wolff zum Anlaß, grundsätzlich über Schuld und Strafe, das Böse und die Verdammnis nachzudenken, gerade vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Verdrängung dieser Themen.