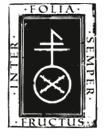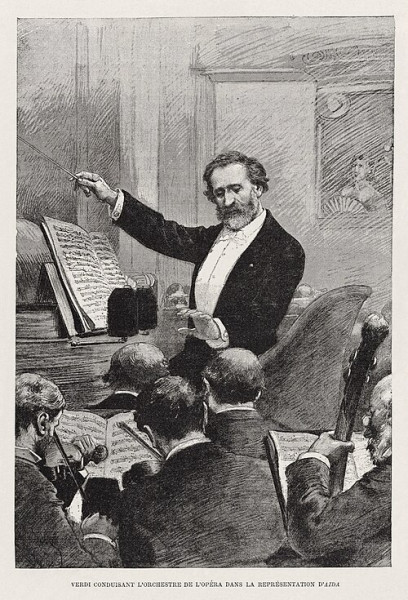LOGBUCH LXXVIII (24. September 2025). Von Michael Rieger
Leporello, Kundry und die allgemeine Sprachverwirrung
Die Verdeutschung oder Eindeutschung populärer italienischer Opern setzt schon mit ihnen selbst im 18. Jahrhundert ein. Wenn etwas populär ist und sein Publikum findet, wird es auch zügig adaptiert, um es noch populärer zu machen. Mozarts und da Pontes Don Giovanni (1787) etwa wurde mit deutschen Texten aufgeführt, wobei die Rezitative zwischen den Gesangsnummern dann als Dialoge gesprochen wurden (eine Singspiel-Technik, die wir noch in der etwas späteren Zauberflöte wiederfinden). Der Grund für die Verdeutschung liegt somit auf der Hand. Wer sprach um 1800 herum denn in Deutschland schon italienisch, von Teilen des Adels abgesehen? So aber konnte auch das bürgerliche Publikum dem Geschehen auf der Bühne folgen, sei es im Opernhaus oder in einem kleinen Theater aufgeführt, und man wußte alles in allem, was da vor sich ging. Und in anderen europäischen Ländern verfuhr man nicht anders. Daß diese Präsentationsform nicht unproblematisch war, sondern mit groben und absurden Textverzerrungen einher ging, darf betont werden.
Verdis Opern waren entsprechend ihrer Popularität auch oft Gegenstand der Verdeutschung. So singt Otto Edelmann noch in den frühen 1960er Jahren seinen Falstaff auf Deutsch (in einer Fernsehfassung). Für die DDR läßt sich gleiches anhand des Don Carlos in der Staatsoper Berlin unter Franz Konwitschny belegen (1960).
Insofern ist es nicht allein im Zusammenhang der NS-Kulturpolitik zu sehen oder zu hören, wenn Don Giovanni im Zweiten Weltkrieg in deutscher Sprache aufgeführt wurde. Das historische Dokument liegt vor: Von 1943 datiert eine Aufnahme im Bestand der Reichs-Rundfunk-Gesellschaft mit der Staatskapelle Dresden unter Karl (hier Carl) Elmendorff, der seit 1927 in Bayreuth dirigiert hatte und auch hier als Nachfolger Karl Böhms in Dresden mit großen Namen wie Margarete Teschemacher, Hans Hopf, Kurt Böhme und Gottlob Frick zusammenarbeitet. Die Rezitative werden jedoch nicht mehr gesprochen, sondern gesungen. Leporellos berühmte Register-Arie auf Deutsch zu hören, das ist in der Tat ungewöhnlich, aber es funktioniert dennoch (irgendwie). Was während des Kriegs üblich war, findet seine Kontinuität in der unmittelbaren Nachkriegszeit, etwa in der deutschen Don Carlos-Aufnahme aus dem Jahr 1948, mit Josef Greindl als Philipp II. und Dietrich Fischer-Dieskau als Marquis de Posa, der Dirigent der Städtischen Oper Berlin war Ferenc Fricsay.
Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre brach diese relative Kontinuität aber schließlich völlig ab. Nicht, daß jetzt alle plötzlich des Italienischen mächtig gewesen wären. Aber es war eine Zeit des Übergangs, den Christa Ludwig in ihren Erinnerungen voller Ironie beschreibt (… und ich wäre so gern Primadonna gewesen. 2. Aufl., Berlin 1995, S. 160 f.): „In der Zeit, als Karajan nach Wien kam, 1958, sollten alle Opern in Originalsprache gesungen werden. Da gab es entzückende Vorstellungen von Aida und Carmen. Der Chor von Carmen konnte den Part nur in deutsch und konnte nicht so schnell umlernen. Aber die Solisten sollten französisch singen. So hieß es dann ‚L’amour‘, und der Chor antwortete ‚Die Lieb‘. Bei Aida sangen Solisten und Chor italienisch, doch sagte plötzlich die Aida ab, und die Gastsängerin konnte es nur in deutsch singen. Bei den Terzetten mit Radames und Aida sang ich zu Radames in italienischer und zu Aida in deutscher Sprache. Das war wirklich sehr lustig.“ Es wäre heute recht kontrovers, für deutschsprachige Opernaufführungen von Mozart oder Verdi oder Puccini zu werben, da mehrsprachige Libretti weit verbreitet sind, jeder Operngänger sich ohne große Mühe im Detail auf die dramatischen Konflikte vorbereiten kann und nicht allein auf die Textverständlichkeit im Moment der Aufführung angewiesen ist. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre hielten zudem die Übertitel Einzug in die Opernhäuser, so daß man die (deutsche) Übersetzung des (italienisch) gesungenen Textes direkt mitlesen kann.
Wer käme heute noch auf die Idee, Leporello auf Deutsch singen zu lassen? Was im Namen der Praktikabilität, Popularisierung und Verständlichkeit mit den Opern im historisch begrenzten Moment angestellt worden war, ging voll und ganz zu Lasten der vielfachen Schwingungen der Originalsprache, in welcher das Werk ja nun einmal nicht zufällig komponiert worden war. Auf diese Schwingungen, die Artikulation, die Phrasierungen und die Assoziationen des Originals will heute niemand mehr verzichten.
Eine besondere Aufnahme sei aber noch erwähnt, weil sie die Grenzwertigkeit des ganzen Unternehmens der Übersetzung in die Landessprache, die so lange Zeit über gang und gäbe war, deutlich demonstriert. Haben sich die Deutschen immer herausgenommen, ihren Mozart und ihren Verdi einzudeutschen, so haben die Italiener sich ihrerseits daran gemacht, (nicht nur) den Heiligen Gral der deutschen Opernliteratur, nämlich Wagners Parsifal (1882) ins Italienische zu entführen, jene Oper, die auf des Meisters Geheiß allein für das Bayreuther Festspielhaus reserviert bleiben und an keinem anderen Ort der Erde aufgeführt werden sollte.
Nun also – Parsifal auf Italienisch. Für Wagnerianer zumindest ein veritabler Sündenfall. 1950 war das, ein Jahr bevor die Bayreuther Festspiele wieder eröffnet werden sollten, wo dann auch der Parsifal unter Hans Knappertsbusch erklang, nahmen das Orchestra Sinfonica e Coro della RAI unter Vittorio Gui das Bühnenweihfestspiel auf, mit Maria Callas als Kundry, Boris Christoff als Gurnemanz und Africo Baldelli als Parsifal. Die Zeit, sie ging schnell darüber hinweg und Maria Callas sehr bald sehr andere Wege. Ich will den lyrisch-dramatischen Künsten da Pontes oder anderer Librettisten nicht zu nahe treten, aber bei Wagner fällt die eigenständige und eigenwillige Dichtung noch viel stärker ins Gewicht. Aber – ist denn nicht der originale Parzival ein wahrlich europäisches Ereignis der Literaturgeschichte? Und hat Voß nicht zur Freude der Deutschen Homer übersetzt und haben nicht die Schlegels und Erich Fried Shakespeare und Paul Zech nicht auch Rimbaud zu unserem Genuß übersetzt? Im Ringen um jede Nuance, wohlgemerkt, was bei den Librettisten selten der Fall war.
Hier liegt der Fall aber ganz anders.
Bei der Oper also – wo liegt das Problem? Es liegt in der Konzeption, hier der spezifischen Konzeption des Wagner’schen Musikdramas. Bei ihm ist alles aus einem Guß. Wo nur Information mitgeteilt wird, mag ein anderes Idiom das gleiche leisten (aber selbst in diesem Fall stimmt das nicht ganz!), bei Wagner aber finden wir keine Melodien zum Mitpfeifen oder Arien zum Mitsummen oder schmissige Partien, die sich wie die italienischen Arien von ihren Opern verselbständigen. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht nur werden die für ihn typischen Prägungen und Ausformungen nivelliert, wie „dumpfe Torheit“ oder „Herzeleids Erbrennen“, die kunstvollen Stabreime werden eingeebnet. Noch wesentlicher ist: Bei Wagner sind Drama und Musik in ihrer unbedingten originären Verwobenheit, in ihrer durchkomponierten Symbiotik, gar nicht zu trennen, weshalb die „Übersetzung“ eine Form der Entfremdung und Verfremdung des Aufeinander-Bezogenseins von Gesang/Text und Musik darstellt. Ähnlich läge die Sache bei Debussy oder Richard Strauss – Pelléas et Mélisande auf Norwegisch oder eine portugiesische Salome? Das muß auch nicht sein.
Sei’s drum. Kulturgeschichtlich ist das Kapitel erledigt, heute kräht kein Hahn mehr danach. Auf dem historischen Irrweg dieser Nachdichtungs- oder Übersetzungspraxis trieb es jene merkwürdigen Blüten, und ob nun Fischer-Dieskau den Marquis de Posa verdeutschte oder Callas Kundry italienisierte, bei garantiert mittelprächtiger Klangqualität, erscheint all das heute bestenfalls als Versuch einer Vermittlung verständlich.
Ein europäischer (Rück-)Blick auf die USA
Das Verhältnis zwischen Europa und den USA ist heute an einem denkbar unwürdigen Tiefpunkt angelangt. Gemeinsamkeiten, gegenseitiger Respekt, Einsicht in die kulturelle Nähe, die Möglichkeit, voneinander zu lernen, all das steht zur Zeit, zumal in den Augen des neuen US-Präsidenten und seiner Entourage, nicht hoch im Kurs. Das explizit Politische sei hier ausgeklammert, obwohl das heruntergekommene Verhältnis im Umgang miteinander die Folge der Politik ist. Aber herunterkommen kann nur, was einmal auf der Höhe war, und dies soll an einer zugegeben sehr kleinen Facette der Kulturgeschichte veranschaulicht werden.
Es ist gewiß kein Geheimnis, daß die US-amerikanische Kultur spürbar von der Integration europäischer Künstler profitiert hat. Doch die Rede ist nicht von Enrico Caruso, Lauritz Melchior oder Marlene Dietrich. Die Rede ist im folgenden von jenen berühmten Dirigenten, die aus Europa kamen und vor allem die sogenannten „Big Five“, das New York Philharmonic Orchestra, das Boston Symphony Orchestra, das Chicago Symphony Orchestra, das Cleveland und das Philadelphia Orchestra zu den fünf großen, ja führenden Symphonie-Orchestern in den USA machten. Es ist erstaunlich – als hätte es damals in Budapest ein wahres Nest gegeben, wurden diese Orchester in den wichtigen Jahrzehnten zwischen 1920 und 1960 von Dirigenten aus Budapest geleitet. Eugene Ormandy kam schon 1921 in die USA. Er wurde zum Chefdirigenten des Philadelphia Orchestra. Fritz Reiner tat es ihm 1922 nach, sein Name ist insbesondere mit dem Chicago Symphony Orchestra verbunden. Bekanntermaßen folgte ihm Georg Solti in den Jahren 1969 bis 1991 in dieser Position in Chicago nach. George Szell ging 1939 nach New York, sein Name ist untrennbar verbunden mit dem Cleveland Orchestra. Antal Dorati muß als fünfter im Bunde aus Budapest genannt werden, der aber in Dallas und Detroit tätig war. Die Liste der berühmten Namen ist beeindruckend und weitere ließen sich nennen, allen voran Arturo Toscanini und der Berliner Bruno Walter, die in New York Maßstäbe setzten; der Breslauer Otto Klemperer und später dann Zubin Mehta aus Bombay, die beide in Los Angeles ihre Spuren hinterließen, Mehta dann auch in New York … William Steinberg war 1938 via Palästina in die USA gekommen, um dann in Pittsburgh und Boston zu arbeiten. Erich Leinsdorf soll nicht unerwähnt bleiben, der schon 1938 an der Metropolitan Opera dirigierte. Sie alle zählen zu den Emigranten/Exilanten, die das Konzertleben in den USA auf ein Niveau gehoben haben, das seinesgleichen suchte. Ormandy, Reiner, Szell, Dorati, Klemperer, Walter, Steinberg, Leinsdorf, Solti besitzen alle einen jüdischen Familienhintergrund, und daß Toscanini Katholik war, dürfte niemanden überraschen. Die einen hatte der Krieg in die USA verschlagen, den sie in der Neuen Welt überlebten, die anderen waren schon vorher gekommen (auch sie waren nicht die ersten gewesen, denken wir nur an Gustav Mahler), während Männer wie Zubin Mehta oder Pierre Boulez, der Leonard Bernstein in New York beerbte, bereits zu einer Generation zählten, deren musikalisches Schicksal nicht mehr direkt mit dem Krieg in Zusammenhang stand. Und es sei auch gesagt, daß die genannten Dirigenten später an anderen Orten Wirkungsstätten gefunden haben, die ihrer Arbeit in den USA in nichts nachstanden – ich erinnere nur an Leinsdorfs Tosca in Rom (1957), Klemperers Beethoven-Zyklus (1955 bis 1960) und die legendäre Fidelio-Aufnahme (1962) in London, oder Zubin Mehtas Arbeit mit dem Israel Philharmonic Orchestra (das William Steinberg begründet hatte).
Dennoch ist es interessant zu sehen, wie sich in den USA nach und nach (und mit den fraglos vorhandenen Mitteln) ein Konzertwesen entwickelt hat, das ohne die europäischen Standards wohl nicht hätte gedeihen können und bald mit Leonard Bernstein oder Lorin Maazel selbst internationale Anerkennung fand. Zusammenfassend ist ein Hochmut aus US-amerikanischer Perspektive ausgeschlossen – ohne die europäischen Dirigenten wäre man längst nicht so weit gekommen. Und ein europäischer Hochmut gegenüber der Musikwelt in den USA konnte ebenso wenig entstehen, da jene bedeutenden Klangkörper von den Europäern ja selbst mitgeformt waren, mit großem Erfolg, ja noch bis heute herausragend nachhallend, man höre nur, aus der Fülle herausgegriffen, Rimsky-Korsakows Scheherazade unter Reiner (Chicago 1960) oder Ormandys Klassische Symphonie von Prokofiew (Philadelphia 1961) oder Holsts Planets unter Steinberg (Boston 1970) oder Mehtas Version der Fünften Symphonie von Mahler (Los Angeles 1976). Zudem liegt hier eine besondere Konstellation vor, indem dieser Standard wiederum auf Europa zurückwirkte. So war es nicht zuletzt das hohe Niveau der US-amerikanischen Orchester, das Herbert von Karajan vorschwebte, als er die Berliner Philharmoniker in der Nachfolge Furtwänglers zu jenem maßstabsetzenden Orchester in Deutschland machte, das es dann bis zu seinem Tod und darüber hinaus war und ist.
In den Jahrzehnten seither hat sich jenseits des Atlantiks eine Musik- oder Konzertwelt entwickelt, die zwar unbedingt auf dem beschriebenen Fundament ruhte, sich aber gleichzeitig mit jeder neuen Generation von den genannten Faktoren emanzipierte. Welche Konsequenzen das aktuelle geistlose, geistfeindliche Klima in den USA noch zeitigen wird, ist noch nicht abzusehen. Doch darf man mutmaßen, daß Ormandy, Reiner, Szell, Leinsdorf und die anderen unter den heutigen Umständen die entgegengesetzte Himmelsrichtung einschlagen würden.
Die erste „Randnotiz“ hatte Bach und das Klavier zum Thema, siehe hier.
Abbildung: Giuseppe Verdi 1880 als Dirigent der Aida in Paris (Zeichnung von Adrien Marie, 1881; Wikimedia Commons)