LOGBUCH LXXIV (15. Juni 2025). Von Uwe Wolff
I
Der Hildesheimer Mariendom mit seinem tausendjährigen Rosenstock gehört zum Weltkulturerbe. In ihm befinden sich zwei Bronzegüsse Bischof Bernwards (um 950–1022). Die Bilderfolge einer zweiflügeligen Tür beschreibt den Sündenfall und die Erlösung des Menschen. Auf einer Bronzesäule ist der Weg Christi dargestellt. Das Kunstwerk steht etwas verloren vor dem Eingang zur Krypta. Ich steige die Treppen hinab in eine Welt ohne Gebet. Keine Opferkerze brennt vor der Statue der Muttergottes und ihres Kindes. Ich sehe ein kleines silbernes Reliquiar, das in der Gründungslegende des Domes die zentrale Rolle spielt: Es hat die Form eines Halbmondes und enthielt einen Ärmel von jenem Gewand, das Maria trug, als der Engel Gabriel ihr die Geburt des Erlösers verkündete.
Maria gegenüber befindet sich der Eingang zur Gruft. Ich habe sie gelegentlich besucht. Noch einmal führen Stufen hinab in eine neu geschaffene Grablege der Bischöfe von Hildesheim. Hier ruhen eingemauert und nur durch eine Grabplatte namentlich gekennzeichnet Heinrich Maria Janssen (1907–1988), der am 26. März 1960 den wiederaufgebauten Dom seiner Schutzpatronin konsekrierte, Josef Homeyer (1929–2010) und Joseph Godehard Machens (1886–1956).
Der derzeitige Bischof von Hildesheim, Heiner Wilmer (*1961), hat die Gruft schließen lassen. Forderungen nach einer Entfernung der Leichen hat er sich bisher nicht gebeugt. Er selbst glaubt vermutlich, eines Tages hier keine letzte Ruhe finden zu können. Die Bischöfe von Hildesheim werden ab sofort außerhalb des Domes auf dem St.-Annen-Friedhof beigesetzt werden. Der resignierte Bischof Norbert Trelle (*1942) wird den Anfang machen, wenn es Kulturkampf und Kirchenkritiker zulassen.
Unmittelbar nach seiner Weihe (2018) hatte Wilmer durch ein Gremium alte Vorwürfe gegenüber Heinrich Maria Janssen klären lassen wollen. Zuerst war die Rede vom regelmäßigen Mißbrauch eines Ministranten zwischen 1958 und 1963. Wilmers Vorgänger hatte, als die Vorwürfe im November 2015 öffentlich wurden, mit einer Zahlung von 10.000 Euro, aber ohne Anerkenntnis einer Schuld, den Fall regeln wollen. Nach einer Plausibilitätsprüfung folgte er damit der Empfehlung der zentralen Koordinierungsstelle (ZKS) der Deutschen Bischofskonferenz.
Wilmer glaubte nicht an einen Einzeltäter. Inspiriert von dem Kirchenkritiker Eugen Drewermann und wenig erfahren im Umgang mit den Medien erklärte er in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger, der allgemeine Machtmißbrauch liege in der DNA der Kirche. Die Untersuchungskommission bestätigte die These des Bischofs und stellte bald ein Sodom und Gomorrha in der Diözese Hildesheim fest. Vielleicht gehört es zur Eigendynamik von Aufklärungsprozessen, daß sie immer mehr Aufzuklärendes aus der Latenz ins Licht ziehen. Dann ist die Luft von Spuk so voll, daß niemand weiß, wie er ihn meiden soll. Wie errichtet man Brandmauern gegen das Böse? Was ist wirklich geschehen? Wer waren die Täter? Wie glaubwürdig waren die Opfer? Wie soll die Kirche mit jenen Menschen umgehen, die Kapital aus dem Mißbrauch schlagen? Wie geht sie um mit einer explosiven Dynamik der Forderung nach Schmerzensgeld? Wie verhandelt sie mit jenen Gremien und Bewegungen, die den Mißbrauch zur Dekonstruktion der katholischen Lehre mißbrauchen? Wie geht ein Bischof um mit einem Priester, der sich mit einer Kinderschar gegen einen Weihbischof stellt und ihm die Ausübung seines Amtes bei der Firmung verweigert? Welche Sühne und Sühnefeiern, welche Akte der Buße können einem Fegefeuer gleich die Schuld der Schuldigen läutern? Der Fragen ist kein Ende.
Der dänische Film „Die Jagd“ (2012) beschreibt den Fall eines Erziehers, gespielt von Mads Mikkelsen, der durch falsche Beschuldigungen als Mißbrauchstäter stigmatisiert und verfolgt wird. Das vom katholischen Filmwerk ausgezeichnete und mit einer Arbeitshilfe erschlossene Seelendrama über Mobbing, Rufmord und Lynchjustiz führt in die Psychologie eines vermeintlichen Opfers. Der Täter ohne Tat und Tatabsicht erweist sich als Konstrukt einer verwirrten und überforderten Wahrnehmung. Mißbrauch, wie er hier dargestellt wird, kann auch eine Projektion sein. Doch wer will das im Einzelfall feststellen? Bis zu einer rechtmäßigen Verurteilung sollte auch für einen Bischof die Unschuldsvermutung gelten. Doch wird ihre Einforderung zum Teil einer Beschuldigungsstrategie, aus der es kein Entkommen gibt. „Semper aliquid haeret“ – irgendetwas bleibt immer hängen.
II
Bei meinem Besuch der Krypta stehe ich heute vor verschlossener Tür. Der Ort des Gedenkens und der Fürbitte für die Seele der Verstorbenen ist zum Kerker der damnatio memoriae geworden. Niemand soll sich des Namens erinnern. So hatte es bereits der zuständige Hildesheimer Ortsrat beschlossen, als er eine Umbenennung der Bischof-Janssen-Straße beschloß. Auf einer Hinweistafel vor der Gruft lese ich:
„Im Bistum Hildesheim werden gegenwärtig Formen der Erinnerungskultur zum Leide von Betroffenen sexualisierter Gewalt diskutiert. Dabei geht es auch um den reflektierten Umgang mit Gräbern. Über diese Fragen beraten aktuell die Gremien der Diözese.
Bis zu einem Ergebnis bleibt die Gruft der Bischöfe verschlossen.
Das Domkapitel“
III
Heinrich Maria Janssen war ein sehr beliebter und volkstümlicher Bischof. Lebte er heute, so wäre er gewiß ein entschiedener Förderer des synodalen Weges. Am 29. Juli 1934 wurde er in Münster zum Priester geweiht. Sein Bischof war Clemens August Graf von Galen, jener Hüne und „Löwe von Münster“, der seine Stimme mutig gegen die Euthanasie erhob und nach dem Krieg in den Kardinalsstand erhoben wurde. Heinrich Maria Janssen war ein Modernist. Bei der Diözesansynode 1968 hatten erstmals Priester und Laien gleiches Stimmrecht. Er glaubte an den Geist der Erneuerung, der über dem Zweiten Vatikanischen Konzil geschwebt haben sollte, und er trieb mit viel Energie eine Modernisierung seines Bistums und eine Liberalisierung kirchlicher Strukturen voran.
Am Kolpingtag in Celle (1963) wurde er sogar euphorisch: „Allerorten und allerenden spüren wir das Neuwerden und den Aufbruch in größere Räume.“ Dabei verlor er nicht die Bodenhaftung und blieb Realist und Pragmatiker. Angesichts dramatisch zurückgehender Berufungen von Priestern motivierte er die katholischen Familien, Hauskreise zu gründen und dadurch die Kinder zum Glauben zu führen. Nur so könnten der Kirche neue Priester und Ordensleute geschenkt werden. Den Nachwuchs hatte der junge Bischof vor Augen, als er am Tag seiner Weihe die Jugend der Stadt und des Stiftes fragte: „Kann ich mich auf Euch verlassen?“ Er konnte. Über viele Jahre bot er im Hildesheimer Dom eine „Frühschicht“ vor Schulbeginn an: Sechs Uhr morgens, jeden Samstag. „Und sie kamen zu Hunderten im Sommer und im Winter, jahrelang. Sie waren alle stolz, daß sie etwas leisteten.“ Noch vor seiner Konsekration (14. Mai 1957) im Marienmonat Mai war er zu den Wolfsburger VW-Werken und dann auf den Wohldenberg gefahren, jener alten Burg an den Bodensteiner Klippen, die seit Kriegsende Zentrum der katholischen Jugendarbeit war. In seinem ersten Hirtenwort wandte er sich an die Jugend und sprach von einer Erneuerung der Kirche. Sie sollte sich wie alle kommenden Reformwege als Illusion erweisen. Bald standen die Priester auf der roten Liste.
„Und damit bin ich nun schon bei Dir, meiner so herzlich geliebten Jugend! Noch bevor ich die hl. Bischofsweihe empfing, gleich am ersten Tage nach meiner Ankunft in Hildesheim, bin ich zum Wohldenberg gefahren, zu Eurem Wohldenberg, und habe mich dort überzeugt davon, daß dort eine Zentralstelle Eurer Jugendarbeit ist. Ich wollte Euch damit sagen: Der Bischof gehört zur Jugend, und die Jugend gehört zu ihm. Ich werde immer bei Euch sein, wenn Ihr, wo immer auch in der Diözese, als Jugend der Kirche zusammenkommt. Ihr Jungen und Mädchen seid unsere große Hoffnung. Aus Euren Reihen erwarte ich die Helfer und Helferinnen für den Bau des Gottesreiches in der Diözese. Aus Eurer Schar werden die Priester und Ordensleute wachsen.“
In den Gemeinden diagnostizierte er in seiner Rede vor der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (1982) Sprachlosigkeit, Unvermögen und Unbeholfenheit und empfahl Familiengottesdienste: „Die Verkündigung sollte viel mehr familienbezogen sein, nicht nur am Familiensonntag oder zu den Gedenktagen der Familie.“ Jugendgottesdienste seien gut, besser aber eine Messe, die auch Jugendliche anspricht. Janssen engagierte sich für den Religionsunterricht. Er ermunterte seine Priester, sich zu Gemeinschaften nach dem Vorbild Charles de Foucaulds oder der Fokolar-Bewegung zusammenzuschließen. Er ließ Kirchen für die zahlreichen vor sowjetischer Gewalt und Mißbrauch Geflüchteten errichten. Heute herrscht in vielen dieser Gotteshäuser gähnende Leere. Heinrich Maria Janssen hatte als junger Priester im Osten des Deutschen Reiches gewirkt und, gegen das ausdrückliche Verbot der Partei, polnische Kinder getauft und die Asche der Ermordeten aus den Lagern beigesetzt. Er hatte wie alle Vertriebenen den erbarmungslosen Terror der sowjetischen Soldaten erlebt und engagierte sich auch deshalb als Beauftragter der Bischofskonferenz für die Vertriebenen- und Flüchtlingsseelsorge. Als er Weihnachten 1957 zum ersten Mal die Mitternachtsmesse in der Barackenkapelle des Lagers Uelzen zelebrieren wollte, verschlug es ihm die Stimme und seine Tränen flossen. Die Stelle, wo es heißt „In der Herberge war kein Platz für sie“, überwältigte ihn.
Bischof Janssen besaß das Tränencharisma. Er baute eine „Gastarbeiter-Seelsorge“ auf, und er engagierte sich für Flüchtlinge aus Vietnam. In Bergen-Belsen weihte er eine Sühnekirche zum Gedenken an die schändlich mißbrauchten Opfer der Diktatur. Er war ein Freund und Förderer der Ökumene, er inspirierte kirchliche Gremien und Vereine und er engagierte sich, wohl aus dem Geist seines Münsteraner Bischofs, für Menschen mit Behinderung. In Diekholzen gründete er die Heimstatt Röderhof. Sie bietet noch heute Wohn- und Förderangebote im Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen. Janssen plädierte gegen die Nutzung der Atomenergie und beugte sich nicht vor jenen Argumenten, die deren Unverzichtbarkeit zur Erhaltung des Wohlstandes behaupteten. Heute wäre er mit dieser Haltung gewiß Ehrenvorsitzender von „Opas for Future“: „Dann müssen wir wieder zu einer schlichten Lebensweise zurückfinden. Dann sparen wir viel Energie und Geld für jene, die auf der Schattenseite leben, und für die kommenden Generationen, die auf den Reichtum der Schöpfung genauso einen Anspruch haben wie wir.“
IV
Ein Schatten liegt über jeder Seele. Er gehört zur DNA des Teufels und der Menschen, wie die Geschichte vom Sündenfall zeigt. Die Bibel wäre nicht das Buch der Bücher, wenn es die Schattenwelt verschwiege. Schon im vierten Kapitel der Genesis wird der erste Mord geschildert. Als es die Menschen nach dem Sühnopfer der Sintflut ärger denn je trieben, resignierte Gott und stellte fest: „Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf.“ (Gen 8,21) Vom Umgang mit dem Mißbrauch und seinen Folgen erzählt der Untergang von Sodom und Gomorrha. Zwei Engel besuchen Lot. Da überfallen Männer das Haus und fordern die Herausgabe der Engel, um sie zu vergewaltigen (Gen 19,5). Lot aber ist bereit, statt ihrer seine jungfräulichen Töchter zu opfern: „Ach, liebe Brüder, tut nicht so übel! Siehe, ich habe zwei Töchter, die wissen noch von keinem Manne; die will ich herausgeben unter euch, und tut mit ihnen, was euch gefällt; aber diesen Männern tut nichts, denn darum sind sie unter den Schatten meines Daches gekommen“ (Gen 19,7f.). Zum Glück unterbrechen die Engel diesen Wahnsinn und schlagen die Mißbrauchstäter mit Blindheit. Lot und seinen Töchtern aber raten sie, die Stätte zu verlassen, denn in einem Höllenfeuer werden Sodom und Gomorrha untergehen.
Die Höllenstrafe ist die Antwort auf den Mißbrauch. Vom Teufel in den eigenen Reihen und der Hölle ist in der Kirche nicht mehr die Rede. Kann es für überführte Mißbrauchstäter Vergebung geben? Eine ganz üble Geschichte ist die Verführung der Bathseba und die Ermordung ihres Mannes Uria durch König David (1 Sam 11). Leonard Cohen hat diese übergroße Schuld in seinem Lied „Halleluja“ als Ursprungsszene des Glaubens gedeutet. Der vierte Bußpsalm ist ein Dokument der Reue, die David nach seiner Tat ergriffen hat. Die Verse beschreiben einen Prozeß der Läuterung nach der Konfrontation mit dem Schatten der Sünde: „Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten“ (Ps 51,19).
Die verschlossene Gruft ist ein Akt der Verdrängung, ein Augenschließen vor dieser Dimension des Glaubens. Sie ragt über alle irdischen und juristischen Fragen in eine andere Welt, wo Urteile in letzter Instanz gesprochen werden. Davon ist in der sogenannten Aufarbeitung noch nicht ansatzweise die Rede. Wie immer das Urteil der Gremien und Gerichte ausgehen wird, wie genau die Frage der Glaubwürdigkeit der Betroffenen und Zeugen geklärt werden wird, das letzte Wort wird kein irdischer Richter sprechen. Schuld und Sühne, Sünde und Vergebung gehörten einst zu den Kernkompetenzen der Priesterschaft. Die Beichtstühle sind weitgehend abgeschafft worden oder werden als Besenkammern benutzt. Wohin gehen mit der Schuld? Mit dem Himmel wurde die Hölle abgeschafft. Der mittelalterliche Radleuchter des Hildesheimer Domes, der einst über dem Altar schwebte, um die transzendierende Dimension der Liturgie als Teilhabe am himmlischen Lobpreis der Engel anzudeuten, wurde nach der letzten Renovierung über den Bänken der Gemeinde aufgehängt.
Die Kirche war über Jahrhunderte eine Vermittlerin des Heils und der Heilung. Vieles konnte sie vergeben, aber nicht alles. Es gibt Grenzbereiche, da hilft zur Sühne auch nicht der Gnadenschatz der Kirche und die Fürsprache der Heiligen. Die Zeitungen der Gegenwart sind übervoll von Beispielen des Mißbrauchs auf allen Ebenen. Kann den Menschenschindern und -mördern vergeben werden? Sollen die Opfer von Bergen-Belsen und anderen Stätten des Grauens auch noch im Jenseits ihren Mißbrauchstätern ins Auge schauen müssen? Es gibt eine Sünde wider den Heiligen Geist, die nicht vergeben werden kann. Und Jesus sagt: „Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Abfall verführt, für den wäre es besser, daß ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist.“ (Mt 18,6) Die Christussäule am Eingang der Krypta zeigt eine Schlüsselszene aus der jenseitigen Welt. Dort sitzt der reiche Mann und Prasser (Lk 18,19–31), der erbarmungslos über das Leid des armen Lazarus hinwegsah. Nun hockt er in der Hölle und bereut seine Taten. Aber die unterlassene Hilfeleistung ist nicht mehr gutzumachen.
V
Ich steige mit vielen Fragen aus der Krypta empor und möchte am liebsten am Denkmal Bischofs Bernwards vorbei und über den Domhof zu Bischof Heiner Wilmer gehen, um ihm meine Fragen zu stellen über das Geheimnis jener DNA der Sünde, über das Geheimnis der Bosheit (mysterium iniquitatis, 2 Thess 2,7), das Weltgericht und den feurigen Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, und die Tränen, die von Gott abgewischt werden. Aber ich bleibe bei strahlendem Sonnenschein vor dem Denkmal des großen Heiligen stehen. Ich blättere in der Anthologie „Unterwegs“ (1982) mit Texten von Heinrich Maria Janssen und stoße auf eine Predigt, die er anläßlich des vierzigjährigen Priesterjubiläums gehalten hat. Für diesen Moment des Innehaltens hatte sich der Bischof das Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus ausgesucht. Er sprach von seinen Erfahrungen im Dritten Reich, dem folgenden „Jahrzehnt in Trümmern, in Not, im Zusammenbruch und Neuanfang, eine Zeit der Vertreibung und der Heimatlosigkeit und der Suche nach Bleibe, nach Gemeinde und neuem Altar.“ Jetzt im Jahr 1974 scheint er aller Illusionen ledig geworden zu sein: „Es hat den Anschein, als ob der Herr seine Kirche ihres Glanzes, ihres Besitzes entkleiden wolle, um sie zu entleeren und von allem, was aus der Sicht des Diesseits Erfolg, Position, Einfluß sein könnte.“ In diese Kenosis wurde der Bischof hineingezogen. 1975 erschütterte ihn die Wiedergabe von Verdis „Requiem“ aus der St. Pauls-Kathedrale in einer Live-Übertragung vom Karfreitag: „Libera me, Domine, de morte aeterna“ – „Befreie mich, Herr, vom ewigen Tode.“
Wer könnte sich so eindeutig in die Richterrolle begeben, daß ihm oder ihr dieser Ruf erspart bliebe? Vielleicht sollte gerade zu diesem Zweck die Krypta als Stätte des Gebetes rasch geöffnet werden? Und noch ein quälender Gedanke beschäftigt mich. Ein Freund schrieb mir seine Einschätzung der Lage: Der wegen Mißbrauch angegriffene Bischof sei eine ganze Zeit mit dem Rückenwind des Zeitgeistes gesegelt. Jetzt sei er Teil einer Institution, die final erledigt werden solle. Da seien die Meriten der Vergangenheit nutzlos. Eine einzige Anklage reiche. Die Sperrung der Grablege nennt er hochsymbolisch: Man wolle die Kirche, ihre substantielle Verzeihung, treffen, nicht den Einzelnen. Christen und sogar Bischöfe überschlügen sich geradezu, daran mitzuwirken.
Zeit seines Lebens war der Bischof von Krankheiten verschont geblieben. Am 3. Juni 1988 erlitt er bei der Zelebration in seiner Hauskapelle einen leichten Schlaganfall. Professor Heinrich Knauf (1938–2019) betreute ihn auf seiner Privatstation im Bernward-Krankenhaus. Die gesundheitliche Lage spitzte sich rasch zu, sodaß der Arzt am 23. September die Krankensalbung empfahl. Sie wurde von Domkapitular Georg Aschemann durchgeführt. Die Geschwister reisten an. Am 6. Oktober wurde eine vierstündige Bypass-OP durchgeführt. S. Edelfried und S. Franzis wachten nachts am Bett. P. Romanus Schäfers SDS sprach die Sterbegebete. Der Bischof konnte nur noch flüstern: „Herr, erlöse mich!“ Am 7. Oktober um 10:15 Uhr starb er im Bernward-Krankenhaus. Eine Woche später fand die Begräbnisfeier in St. Godehard statt. In einer Prozession wurde der Sarg in den Dom überführt. Kardinal Karl Lehmann hielt die Predigt. Dann wurde der Sarg durch das Mittelschiff und das rechte Seitenschiff des Domes zur Gruft getragen. Der Kardinal inzensierte ihn und sprach: „Dein Leib war Gottes Tempel.“
Abbildung: Krypta des Hildesheimer Doms (1911 veröffentlichte Aufnahme, Wikimedia Commons)
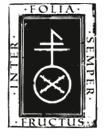

ausgezeichneter Kommentar/Artikel
Hervorragende theologische - gedankliche Durchdringung!
Das Verhalten der Hildesheimer kath.Kirche sehe ich genauso kritisch, äusserst kritisch, um nicht zu sagen: ich finde es total falsch.