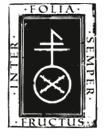LOGBUCH LXXI (16. März 2025). Von Martin Thoms
„Ich liebe die Vorstellung vom Fegefeuer!“ Wenn ich diesen Satz voller Überzeugung in Gesprächen mit meinen protestantischen Freunden ausrufe, ernte ich verwunderte Blicke. Sie schauen mich an, als fragten sie sich: „Haben wir diese schreckenserregende Irrlehre nicht seit Luther überwunden?“ Und sie haben recht. Die Lehre vom Fegefeuer ist in der christlichen Theologie umstritten, weil sie einige Probleme mit sich bringt. Kritiker verweisen auf die mangelnde biblische Grundlage, vermuten eine selbsterlösende Werkgerechtigkeit und erwähnen den problematischen geschichtlichen Kontext des Mittelalters, in dem die Idee vom Fegefeuer dazu genutzt wurde, Menschen durch Ablässe das Geld aus der Tasche zu ziehen, nachdem ihnen höllische Ängste vor jenseitigen Strafen eingeredet wurden. All das meine ich natürlich nicht, wenn ich sage: „Ich liebe die Vorstellung vom Fegefeuer!“ Was diese Menschen ablehnen, lehne ich auch ab, und zwar ganz entschieden. Aber man kann auch anders vom Fegefeuer sprechen. Durch die folgenden Ausführungen wird sich zeigen, daß das Fegefeuer eine frohe Botschaft und eine echte Alternative zur Höllenlehre sein kann.
In seinem Buch Das Jüngste Gericht. Hoffnung über den Tod hinaus stellt Ottmar Fuchs die Notwendigkeit des göttlichen Gerichts angesichts der Leiden der Opfer heraus: „Angesichts des unermesslichen Leidens, das die Menschen den Menschen antun, verbindet sich die Frage nach Gott elementar mit der Frage danach, ob die Opfer ewig verloren sind und ob die Täter ewig triumphieren können oder ob es einen Gott gibt, der intervenieren wird, der nicht alles ‚egal‘ ausgehen lässt, sondern eine Zäsur setzt, in der die Opfer gerettet und gehört und in der die Täter angeklagt und zur genugtuenden Rechenschaft gezogen werden. Gibt es kein diesbezügliches Gottesgericht, dann wäre ein Weiterleben nach dem Tod letztlich durch die Verhöhnung der Opfer und die nachträgliche Legitimation der Täter erkauft. Aus der Gerichtsperspektive träfe sich eine solche Eschatologie mit dem Atheismus, der ebenfalls davon ausgehen muss, dass es für die geschichtliche Aporie des Leidens und der Ungerechtigkeit keine Lösung gibt.“[1]
Die entscheidende Frage ist also: Wird es am Ende Gerechtigkeit geben? Und wie wird sie aussehen? Wie kann es möglich werden, daß die Täter zur Rechenschaft gezogen werden, ohne daß sie selbst zu ewigen Opfern in der Hölle werden müssen, was bloß eine Umkehrung der Täter-Opfer-Dualität wäre. Gerechtigkeit ist erst dann geschaffen, wenn Opfer und Täter sich versöhnt in die Augen schauen können, nicht indem eine Partei – welche auch immer – weiterleidet. Die Frage, wie das möglich ist, beantwortet Fuchs mit dem Hinweis auf die Liebe Gottes. „Alle erfahren sich, wer immer sie waren, in die Liebe Gottes aufgenommen. Niemand wird mit Liebesentzug bestraft. Aber genau das verschärft das Gericht, denn als derart unbedingt Geliebte sehen die Menschen ihre Taten und die Opfer mit einem anderen Blick, mit dem Blick brennender Liebe“.[2] In den Augen der reinen Liebe wird die eigene Nicht-Liebe schmerzlich offenbar, sodaß die „Täter elementar existenziell, durch ihre ganzen schmerzempfindlichen Fasern hindurch (seelisch und leiblich) restlos zum schutzlosen und radikal geöffneten Resonanzboden dessen werden, was sie getan oder versäumt haben.“[3]
Die Erfahrung der unbedingten Liebe Gottes führt also zum Schmerz der Liebe an der eigenen Nicht-Liebe. „Dieser wie Feuer brennende Schmerz reicht bis in Gottes unendliche Liebe hinein und geht tiefer als jede Strafe außerhalb dieser Liebe.“[4] Es geht hier nun nicht mehr um Vergebung oder Verurteilung, denn Leid kann nicht vergeben werden, sondern um die Heilung an der Wurzel des Übels, nämlich der eigenen Empathie- und Lieblosigkeit.[5] Damit wird das zugefügte Leiden kraft der Empathie erlebt, aber als Gnade empfunden,[6] denn der Täter wird nicht nur zum Resonanzboden dessen, was er getan oder versäumt hat, sondern darin gleichsam zum Resonanzboden der mitleidenden Liebe Gottes. Durch die mitleidende Liebe der Täter kann es zu einer Begegnung mit den Opfern kommen auf dem Niveau ihrer eigenen Verletzung.[7] Durch die Versöhnung zwischen Täter und Opfer werden nicht nur die Täter von ihrem Tätersein, sondern auch die Opfer von ihrem Opfersein befreit. „Diese Befreiung vom Opfersein kann aber nicht als Leistung gefordert werden, vielmehr darf daran gedacht werden, dass Christus die Opfer in sein eigenes Opfersein am Kreuz aufnimmt und ihnen genau an diesem Ort das ermöglicht, was er selbst von dort aus getan hat, nämlich den Tätern zu vergeben.“[8] Die Taten der Täter und die Leiden der Opfer werden im Prozeß der läuternden Liebe Gottes, die dem Täter Liebe und den Opfern Befreiung schenkt, nicht einfach negiert, sondern verklärt. Wie die Wunde des Opfers zur verklärten Narbe wird, so wird auch die Tat des Täters eine „durch die Versöhnung gegangene und ‚geklärte‘ Erinnerung an die alte Welt und ihre Leiden“.[9] So vollzieht sich das Jüngste Gericht – so könnte man im Anschluss an Fuchs sagen – letztlich in einem Dreischritt[10]:
1. Zunächst begegnen alle Menschen, Täter wie Opfer, der bedingungslosen Liebe Gottes. Sie erfahren sich als bleibend Geliebte.
2. Darum aber offenbart sich der Schmerz über die eigene Nicht-Liebe. Der Mensch wird zum Resonanzkörper der Leiden derer, denen er Leid zugefügt hat und gerade darin zum Resonanzboden der mitleidenden Liebe Gottes.
3. Durch die Begegnung am Boden der Verletzung kommt es im Vertrauen auf die Kraft der Versöhnung zur Auflösung der Täter-Opfer-Dualität, die verklärte Narben und verklärte Erinnerungen zurückläßt.
Ottmar Fuchs greift das Bild vom Fegefeuer auf. Im Anschluss an Hans Urs von Balthasar spricht er vom Fegefeuer und der Hölle als Aspekte der „Begegnung mit dem lebendigen Gott“.[11] Fegefeuer und Hölle sind hier also nichts anderes als Aspekte der Liebe Gottes, die das Leiden an der (eigenen) Nicht-Liebe beschreiben. Genauso spricht auch Gisbert Greshake vom Fegefeuer. Auch er stellt heraus, daß „Gott selbst, die Begegnung mit ihm, das Fegfeuer ist.“[12] Er fährt fort: „Das Fegfeuer ist keine halbe Hölle, sondern ein Moment der Gottesbegegnung, nämlich der Begegnung des unfertigen und in der Liebe unreifen Menschen mit dem heiligen, unendlichen, liebenden Gott“.[13] Das Fegefeuer ist also keine angstmachende Drohkulisse um – wie zu Luthers Zeiten – Angst und Schrecken zu verbreiten und so den Petersdom zu finanzieren. Sondern das Fegefeuer ist eine Metapher für das Jüngste Gericht, für den Prozeß der heilenden und heiligenden Transformation durch die Liebe Gottes.
Im Anschluß an von Balthasar, Greshake und Fuchs möchte ich versuchen, eigene Worte für das zu finden, was „Fegefeuer“ heißen kann: Fegefeuer ist die Konfrontation mit der Liebe Gottes selbst, die all das, was nicht der Liebe entspricht, wegschmelzen läßt. Fegefeuer ist, wenn Jesus Petrus trotzdem die Füße wäscht. Sein Stolz wird überwunden. Fegefeuer ist, wenn der Vater den Verlorenen Sohn trotz seiner unbändigen Scham in den Arm nimmt. Seine Scham wird überwunden. Fegefeuer ist, wenn das Volk Israel in die Freiheit geführt wird, obwohl es damit völlig überfordert ist. Die Gefangenschaft wird überwunden. Fegefeuer ist, wenn der Täter die Leiden der Opfer am eigenen Leib aus Liebe erfährt. Fegefeuer ist, wenn das Opfer sich von der mitleidenden Liebe des Täters anrühren lässt. Fegefeuer ist also nichts anderes als die Liebe Gottes, die ausgegossen wird in alle Herzen durch den Heiligen Geist (Röm 5,5).
Damit stellt sich nicht die Frage danach, wer am Ende in der ewigen Herrlichkeit der neuen Schöpfung sein wird, sondern was von wem. Alle werden durch heilende und heiligende Feuer der Liebe Gottes erlöst werden: jeder Mensch, jeden Glaubens, jeder Täter, jedes Opfer, alle. Sonst wäre keine Gerechtigkeit geschaffen. Aber was wird übrigbleiben? Welche Identitätsansprüche, welche Charakterzüge, welche Verhältnisse werden Bestand haben? Damit es zu einem wirklich guten Ende kommen kann, braucht es einen Transformationsprozeß, eine Neuschöpfung, eine heiligende Heilung und eine heilende Heiligung. So wie wir jetzt sind, würden wir uns selbst in Ewigkeit nicht aushalten. Es braucht einen Einschnitt, einen göttlichen Bruch, der recht eigentlich ein neuer Anfang ist. Dies ereignet sich gerade nicht dadurch, daß einige Menschen für ewig verdammt werden, sondern darin, daß das Böse wie ein gefährliches Geschwür aus der Seele aller Menschen entfernt wird, sodaß am Ende allein das Bestand hat, was Gott entspricht. Das heißt: Das, was am Ende des heiligenden Heilungsprozesses, dessen Metapher das Fegefeuer ist, übrigbleiben wird, ist das Ebenbild Gottes. So wird erst am Ende die wahrhaft wirkliche Person offenbar. Alle Menschen werden zu sich selbst befreit hinein in das Bild Gottes. So erfüllen sie ihre Berufung (Gen 1,26 f.). In der orthodoxen Theologie wird das theosis (Vergöttlichung) genannt. So mündet diese Lesart des Fegefeuers in eine Phantasie der Allversöhnung. Das Fegefeuer als Metapher für den heilenden und heiligenden Transformationsprozeß Gottes durch seine Liebe ist die universale Verwirklichung des Reiches Gottes für alle, sodaß Gott am Ende alles in allem sein wird (1 Kor 15,28). Das Fegefeuer ist keine angsteinflößende Drohbotschaft vom Heil weniger, sondern die allerlösende Frohbotschaft einer allversöhnten und geläuterten Menschheit.
[1] Ottmar Fuchs, Das Jüngste Gericht. Hoffnung über den Tod hinaus. Regensburg 2018, S. 44.
[2] Fuchs: Das Jüngste Gericht, S. 53.
[3] Ottmar Fuchs: „Weinen und Zähneknirschen“: in oder fern der Liebe? In: Jahrbuch für Biblische Theologie Bd. 36, S. 225–248, hier S. 230 f.
[4] Fuchs: Das Jüngste Gericht, S. 57 f.
[5] Vgl. Fuchs: Das Jüngste Gericht, S. 58.
[6] Vgl. Fuchs: Das Jüngste Gericht, S. 118.
[7] Vgl. Fuchs: „Weinen und Zähneknirschen“, S. 236.
[8] Fuchs: Das Jüngste Gericht, S. 135.
[9] Fuchs: „Weinen und Zähneknirschen“, S. 235.
[10] Vgl. Fuchs: „Weinen und Zähneknirschen“, S. 237 f.
[11] Von Balthasar: Eschatologie, zitiert aus Fuchs: „Weinen und Zähneknirschen“, S. 240.
[12] Gisbert Greshake: Stärker als der Tod. Mainz 1976, S. 92.
[13] Greshake: Stärker als der Tod, S. 92 f.
Dieser Text ist die erweiterte Version eines Kapitels aus dem neuen Buch von Martin Thoms »Es ist vollbracht!« Oder doch nicht? (Leipzig 2025).
Zum Autor: Martin Thoms (*1999) studierte Theologie in Braunschweig und Reutlingen und promoviert im Fach Systematische Theologie an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal. Von 2023 bis 2024 war er Mitarbeiter am Lehrstuhl für Neues Testament und Mitarbeiter am Lehrstuhl für Altes Testament an der Theologischen Hochschule Reutlingen. Er ist Autor der Bücher Der gottverlassene Gott (Münster 2023) und »Es ist vollbracht!« Oder doch nicht? (Leipzig 2025). Zu seinen Lehrern gehörte Jürgen Moltmann, mit dem er bis zu seinem Tod im intensiven Austausch stand.
Abbildung: Stadtpfarrkirche Rohrbach, Aller-Seelen-Altar (1700), Altargemälde: Seelen im Fegefeuer (Wikimedia Commons /