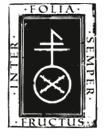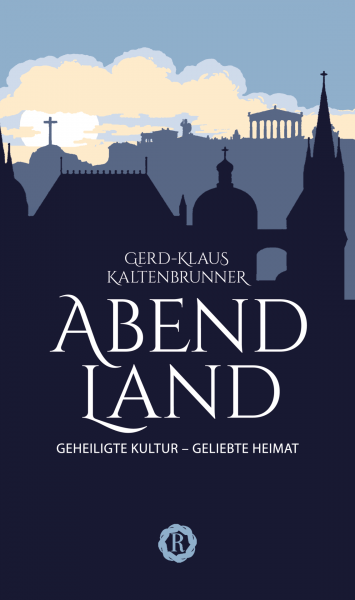LOGBUCH LXXIX (15. Oktober 2025). Von Daniel Zöllner
Gerd-Klaus Kaltenbrunner (1939–2011) hat zu seinen Lebzeiten zwei Trilogien mit Essays über europäische Gestalten publiziert (Europa. Seine geistigen Quellen in Porträts aus zwei Jahrtausenden, 1981–1985, und Vom Geist Europas, 1987–1992). In seinem Spätwerk hat Kaltenbrunner weitere bedeutende Männer und Frauen aus der Geschichte des Abendlandes essayistisch porträtiert. Diese Essays, die etwa in den Zeitschriften „Theologisches“, „Einsicht“ und „Vobiscum“ erschienen sind, lagen bisher aber noch nicht in Buchform vor. Mit dem kürzlich im Renovamen-Verlag erschienenen Band Abendland. Geheiligte Kultur, geliebte Heimat hat sich das geändert: Die verstreut erschienenen Essays liegen jetzt gesammelt vor, ergänzt um einige Texte aus den älteren Trilogien.
Der neu erschienene Band bietet eine fast unerschöpfliche Fülle an Wissen und Leseanregungen. Das Vorwort des Herausgebers Michael K. Hageböck zeichnet nach, wie Kaltenbrunner bei seinen Versuchen, die Vergangenheit zu sichten und zu sieben, was daran standhält, zum katholischen Glauben fand. Eine katholische Grundhaltung prägt die Essays durchgängig. Nach dem einleitenden Essay über Vergil werden zwei Männer des Urchristentums, die uns aus den Evangelien vertraut sind, gewürdigt: die Apostel Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus. Dabei geht es Kaltenbrunner nicht um historisch-kritische Bibellektüre im heutigen Sinn, sondern um eine spirituelle und wirkungsgeschichtliche Würdigung der beiden Brüder und ihrer Bedeutung für das christliche Abendland. So enthält der Essay über Jakobus zugleich Passagen über die Jakobsverehrung und den Pilgerweg nach Santiago de Compostela. Die darauffolgenden Essays über die frühchristlichen Märtyrerinnen Perpetua und Felicitas sowie über den Märtyrer Pankratius machen dem Leser bewußt, daß die katholische Kirche eine Kirche der „Blutzeugen“ war und sein wird.
Unter den Texten, die wichtige Theologen und Philosophen des Abendlandes porträtieren, ist etwa der Essay über Augustinus hervorzuheben. Der Bischof von Hippo „ist schöpferischer Erbe der Antike und Stifter der geistigen Fundamente des christlichen Mittelalters. Auf dem Massiv seiner Theologie ruhte über ein Jahrtausend lang die Dogmatik der katholischen Kirche. Kaum ein Glaubenssatz der kirchlichen Lehre läßt sich ohne Rückgang auf Augustinus erläutern.“ (98 f.) Zugleich aber könne man „an diesem Konvertiten nicht nur studieren, was christlich-mittelalterliche Katholizität bedeutet, sondern überdies noch die Quellen des reformatorischen wie des gegenreformatorischen Christentums finden.“ (99) Außer Augustinus werden aus dem Bereich der Philosophie und Theologie u. a. vorgestellt: Anselm von Canterbury, Joseph Görres und Romano Guardini. Auch neu zu entdeckende Unbekannte wie Ernest Hello und Amadeo von Silva-Tarouca finden ihren Platz in dem Band. Die Essays über sie wecken das Bedürfnis, ihr Werk kennenzulernen. Vielen Lesern mag dies als Anregung dienen, in den Angeboten der Antiquariate zu stöbern. Bedauerlich ist, daß Thomas von Aquin nicht in einem eigenen Essay gewürdigt wird, auch wenn die Anstöße und die zeitenüberdauernde Lebendigkeit seines Denkens an einigen Stellen deutlich werden.
Der Essay über Benedikt von Nursia enthält tiefe Einsichten in die Bedeutung des Mönchtums für das Abendland. Kaltenbrunner gelingt es dabei, die Grundsätze der Benediktsregel erstaunlich frisch und strahlend, als vollständig gegenwartstauglich darzustellen – und zwar nicht nur für Benediktiner und andere Mönche. Die Benediktsregel sei das Werk eines „christlichen Realisten“ (129) und durchdrungen von einem Ethos der Maßhaltung. Den Benediktinern verdankten wir zudem „die Überlieferung fast des ganzen literarischen Erbes der Antike. Ohne ihre emsige Arbeit als Sammler, Kopisten und Editoren wüßten wir heute kaum etwas von Vergil, Horaz, Cicero, Livius, Ovid und Terenz.“ (136)
Im Essay über die Heilige Edigna von Puch heißt es, sie stehe „vor uns für ein Europa, das mehr ist als ein namenloser Großmarkt oder eine von krakengleichen Überbehörden plattgewalzte Masse.“ (157 f.) Dies ist ein häufig wiederkehrendes Motiv der Essays des Bandes. Fast immer stellen sie den Bezug her zur spirituellen Größe Europa, die sich niemals in einem Konstrukt von Managern oder Bürokraten erschöpft. An den gelungensten Stellen dieser Essays offenbart sich im Bruchstück das Ganze, der „Geist“ des Abendlandes. Dann wird ersichtlich, daß der gegenwärtig grassierende Materialismus und Hedonismus eine Auflehnung gegen die europäische Tradition bedeutet. Denn von der Tradition wurde der Mensch, wie Kaltenbrunner immer wieder herausstellt, als ein transzendierendes Wesen verstanden, das seine Erfüllung nirgendwo im Diesseits finden kann, das dafür aber auf eine jenseitige Erfüllung ausgerichtet ist. Wir recken, wie Kaltenbrunner an einer Stelle Dantes Commedia (Paradiso II, 10) zitiert, „die Hälse nach dem Brot der Engel“. Der Komponist Josef Gabriel Rheinberger wird mit folgenden Worten zitiert: „Der eigentliche Nerv der Musik […] ist das Gefühl der Sehnsucht nach einem Glück, das immer vor uns zurückweicht, weil es nur im Ewigen gewährt zu werden vermag.“ (320) Und gilt dies nicht ebenso für die große abendländische Poesie, Malerei und Architektur?
Zahlreiche Essays widmen sich großen Heiligen. Neben der bereits erwähnten Edigna werden etwa Severin von Norikum, Hedwig von Andechs und Johannes von Nepomuk vergegenwärtigt. Und es ist bezeichnend für die Grundhaltung Kaltenbrunners, wenn er an einer Stelle dazu anmerkt: „Es ist schädlich, daß wir uns die Heiligen als völlig verschieden von uns vorstellen, etwa als Alabaster- und Wachsfiguren oder auch als Vogelscheuchen. Denn genaugenommen ist jeder Mensch dazu berufen, ein Heiliger zu sein – auf seine eigentümliche Weise und auf dem Boden seiner naturgegebenen Anlagen.“ (165) Kaltenbrunner fragt im Blick auf das europäische Erbe: „Wissen die Katholiken überhaupt, welche geistigen Schätze ihrer Zuwendung harren und was sie insbesondere an Glaubensermutigung, Glaubenstrost und Glaubensfreude schöpfen könnten?“ (234) Vermutlich wird man diese Frage in den meisten Fällen verneinen müssen. Doch könnte das neu erschienene Buch für manchen immerhin einen Anfang bilden.
Es ist unmöglich, hier alle Essays des Bandes zu würdigen. Staunenswert ist die Fülle an Wissen und Bezügen, die sich darin auftut. Immer wieder werden die Fäden, aus denen die abendländische Geschichte gewebt ist, erkennbar: Der katholische Glaube, das „getaufte“ Erbe der Antike, Griechenlands und Roms, sowie die Völker der Germanen, die den christlichen Glauben annahmen und das Erbe Roms antraten.
Im letzten Essay „Tota Europa. Das wahre Abendland der Heiligen“ findet sich folgendes Bekenntnis Kaltenbrunners, das wohl unter dem Eindruck des Vertrages von Maastricht (1992) verfaßt wurde: „Das Europa, in dem ich mich beheimatet weiß, gleicht – um es paradox zu sagen – eher noch dem fernen Missionsgebiet Polynesiens als jenem nahen, aber antlitzlosen Monster, das in Maastricht wohl unabwendbar auf uns losgelassen worden ist. Der gigantomanischen Vermessenheit und überheblichen Niedertracht dessen, was in einem wohlgeordneten Gemeinwesen nur die unterste Stufe einnehmen dürfte, halte ich unbeirrt die Urgestalten und Denkmäler europäischer Überlieferung und Heiligkeit entgegen.“ (490) Dieses Bekenntnis ist eine Art Schlüssel zu dem Reichtum der Essays. Wer Gefahr läuft, sich in der Vielfalt des Dargestellten zu verlieren und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen, sollte sich dieses Bekenntnis vergegenwärtigen.
In dem Essay über die christlichen Patrone der Bücherfreunde und Autoren schreibt Kaltenbrunner über das Lesen die folgenden Sätze, die auch jeder Leser und jede Leserin seiner Werke zum Leitspruch erwählen könnte: „Lesen in anspruchsvollem Sinne, Lesen unter dem Schutz der Heiligen und in Büchern, die, mittelbar oder unmittelbar, von Heiligem handeln, gehört zu den Obliegenheiten eines Menschen, der sich nicht nur als Produzent, Konsument, Staatsbürger, Parteigenosse oder Eintagsfliege versteht, sondern als transzendenzfähiges Wesen.“ (440) Vielleicht liegt hierin die wahre „Benedikt-Option“ für Europäer, die sich auf ihr Erbe besinnen: „Lesend und wiederlesend errichten wir in einem sich fortschreitend barbarisierenden, reprimitivierenden Weltalter gleichsam unsere Eigenkirchen und Eigenklöster, unsere Hauskapellen und unsichtbaren Zitadellen, höchstwahrscheinlich auch unsere Exile und Katakomben in partibus infidelium [in den Gegenden der Ungläubigen].“ (441)
Die Essays sind detailreich und auch ästhetisch ein Genuß. Entstanden ist ein augenöffnendes Buch, reich an Anregungen nicht nur fürs Lesen, sondern auch fürs Leben, ein mehr als empfehlenswertes, ein notwendiges Buch, dessen eine Rückbesinnung auf die geistigen Quellen des Abendlandes in Zukunft nicht entraten kann.