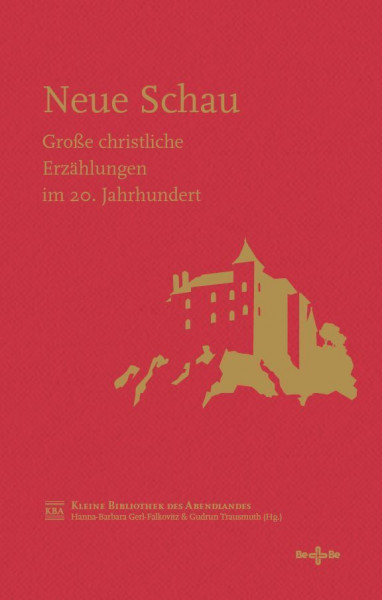LOGBUCH LVI (15. Januar 2024). Von Felix Hornstein
I. Literarischer Schatz des Abendlandes
Es sind oft Zufälle des Verlagswesens, persönliche Bekanntschaften und Verpflichtungen, Fragen der äußeren Gestaltung und auch ganz schlicht Verkaufspreise, die über das Schicksal von Büchern bestimmen. Gute Bücher muß man oft erst einmal finden im großen Urwald des Gedruckten. Wer den Platz nicht beherrscht, wird sich schwertun damit, hier überhaupt gesehen zu werden. Aber es kommt noch etwas anderes dazu: Bücher müssen einen Modegeschmack bedienen, wenn sie Leser finden wollen. Sie müssen, um ein Wort von Martin Mosebach aufzugreifen, wie ungeborene Kinder im Fruchtwasser des Zeitgeistes geschaukelt werden, um gefällig zu wirken und eingängig zu sein. Wehe den Autoren, wenn sie nicht so denken, wie man es von ihnen erwartet. Allzu oft sind es nicht literarische Motive, die zum Verriß oder schlicht zum Daranvorbeigehen führen, sondern ideologische: Man lobt, was einem in den Kram paßt, und vernichtet, was die eigene Position in Frage stellt.
Und so sind viele Autoren heutzutage nicht nur deshalb so gut wie vergessen, weil ihre Zeit schon abgelaufen ist und weil alles in einer schnellebigen Zeit wie der unseren in Vergessenheit gerät, sondern auch deshalb, weil sie auf der falschen Seite standen – und wenn es die falsche Seite des Widerstandes war.
Die „Kleine Bibliothek des Abendlandes“, ins Leben gerufen von Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz und Gudrun Trausmuth, hat es sich zur Aufgabe gemacht, einige fast vergessene Texte der Öffentlichkeit überhaupt wieder zugänglich zu machen, sie zu bewahren als Zeugen einer noch gar nicht so lang vergangenen, aber doch andersartigen Vergangenheit und eines anderen Blicks auf die Dinge, der auch unseren Blick korrigieren könnte. Der Band „Neue Schau. Große christliche Erzählungen im 20. Jahrhundert“ vereinigt Texte von Ruth Schaumann, Werner Bergengruen, Gertrud von le Fort, Reinhold Schneider, Edzard Schaper und Ida Friederike Görres zu einem Reigen, der die Gelegenheit bietet, mehrere Autoren auf engem Raum kennenlernen und vergleichen zu können.
Gemeinsam ist all diesen Texten, daß sie in indirekter, über Bande gespielter Weise versuchen, der Heillosigkeit und Gottvergessenheit der Zeit Orte des Bestehens und Horizonte der Hoffnung abzugewinnen, Dinge, die bleiben und die uns helfen können, zu überdauern. Insofern sind sie – entstanden in den fünf Jahrzehnten seit Ausbruch des Ersten Weltkrieges – allesamt im weiteren Sinne der Literatur des Widerstandes zuzurechnen. Und das ist originär christlich. „Macht euch nicht gemein dem Geist der Zeit“, schrieb der hl. Paulus (Röm 12,2). Aber das gehört wohl zu aller großen Literatur, ja zu allem wahren Leben: Nicht mitschwimmen, sondern nach eigenen Wegen suchen …
Alle abgedruckten Geschichten drehen sich um existentielle Fragen großer Tragweite; alle verdichten die menschliche Situation zu Symbolen, die gleichermaßen die Heillosigkeit unserer Welt und ihr Offensein auf die Wirklichkeit Gottes hin zeigen. Immer geht es um die endgültige Rettung.
Was also kann christliche Literatur leisten? Den großen religiösen Fragen, die oft in der Philosophie zu abstrakt, in der Dogmatik zu schematisch, in der darstellenden Kunst zu verklausuliert und anderweitig gar nicht behandelt werden, einen Lebensraum zu geben, also einen Ort der Entfaltung. Literatur zeigt, wie sich Allgemeines im Konkreten bewährt und vor welche Entscheidungen es die Menschen und, in unserem Falle, die Gläubigen stellt. Sie taucht sozusagen, wenn sie gelingt, die luftigen Gedanken in das Wasser des Lebens.
Das geschieht in diesem Band in zum Teil hervorragender, insgesamt aber doch unterschiedlich gelungener Weise. Nicht alle Texte werden heutige Leser ansprechen können. Und es gibt Hürden, die zu übersteigen sind. Aus diesem Grund taten die Herausgeberinnen gut daran, den abgedruckten Geschichten jeweils eine durchweg sehr kluge, informative und erhellende Einführung voranzustellen. Meine Empfehlung zur Lektüre wäre allerdings, die vorgegebene Reihenfolge abzuändern, d. h. erst die Geschichten zu lesen, dann die Einführungen. Gute Leser sind Wiederkäuer. Es gibt nichts Besseres, als den aus der unmittelbaren Begegnung gewonnenen Eindruck noch einmal zu überdenken und sich ins Weite führen zu lassen. Liest man die Interpretation zu früh, besteht die Gefahr der Verengung.
II. Drei ausgewählte Erzählungen
Ich will nun einen Blick auf drei ausgewählte Erzählungen des Reigens werfen, um die Größe, Besonderheit und Problematik der vorgestellten Texte etwas zu illustrieren.
Ruth Schaumann: „Der gefallene Ismael“
Im Kapitel „Der gefallene Ismael“ aus Ruth Schaumanns eindrücklichem, autobiografisch grundierten Werk „Amei. Eine Kindheit“ von 1932 sehen wir die Welt mit den großen Augen eines Kindes. Ihr „pointillistischer“ Stil, will sagen die Arbeit mit einer Art von Protokollsätzen, ist ein Versuch, die kindliche Wirklichkeitserfahrung wiederzugeben und wiederzugewinnen: Du bist klein, die Dinge um dich herum geschehen, du kennst die Zusammenhänge nicht, vieles ist erstaunlich, manches unheimlich, anderes beglückend.
Es geht um eine Erfahrung des Fremden, um eine innige und sehr positive Begegnung mit Juden, die von der Protagonistin Amei als Angehörige einer ebenso fremden wie faszinierenden Welt erlebt werden, um eine Begegnung, die damit endet, daß sie einen kleinen Buben, der vor ihr hingefallen ist, tröstet und küßt. Dafür wird sie später getadelt, ohne zu verstehen, was daran hätte verboten sein sollen, es war ja nichts Böses daran. Das Kind versteht nicht, aber die Erwachsenen, die das Verbot aussprechen, verstehen auch nicht. Kein Wunder, daß Schaumann in der NS-Zeit das Papier für eine Neuauflage verweigert wurde, als sie sich weigerte, dieses Kapitel zu streichen. Der unbefangene, freie Blick auf das Judentum stand zu deutlich im Widerspruch zur damaligen political correctness.
Werner Bergengruen: „Die Verheißung“
Ganz anders die Erzählung „Die Verheißung“ von Werner Bergengruen. Der baltendeutsche, 1936 in München zur katholischen Kirche konvertierte Dichter schrieb diese Erzählung unter dem Eindruck des Kriegsendes. Und da ging es um die Zukunft eines nicht nur physisch, sondern auch moralisch zusammengebrochenen Volkes. Bergengruen sah klar, daß nach dem Abräumen des Nationalsozialismus nicht nur die äußeren Umstände Deutschlands traurig aussahen, sondern, viel weiter reichend, daß Deutschland in seiner ganzen inneren Verfaßtheit und Existenz in Frage gestellt war: „Wo ist das Volk, das dies schadlos an seiner Seele ertrüge?“ (So Bergengruen im ersten von 17 Gedichten des im Sommer 1944 abgeschlossenen, aber erst 1947 in München erschienenen Gedichtzyklus’ „Dies irae“.)
Aber wie faßt man eine derart komplizierte Situation, einen solchen Knäuel an unauflösbaren Verstrickungen, in denen jeder selbst betroffen war, niemand frei von Schuld und doch auch seinerseits Opfer? Bergengruen wählt, wie auch einige der anderen Autoren, den Weg indirekten Sprechens, indem er zurückgreift auf eine ferne Zeit. Er sucht und findet ein beeindruckendes Untergangssymbol in einer legendären Szene, die sich bei der Eroberung Konstantinopels durch die Türken im Jahre 1453 abgespielt haben soll: Ein Zeuge, der das unfaßbare Geschehen dieses veritablen Weltuntergangs mit den erstaunten Augen eines Kindes hatte mitansehen müssen, beobachtete, wie bei der Erstürmung der Hagia Sophia ein Priester mit der Eucharistie hinter der Ikonostase hervortrat und in gefaßter Unerschüttertheit mit dem Kelch auf die gegenüberliegende Wand zuging, die sich vor ihm auftat und ihn in sich aufnahm.
Das ist eine wuchtige Aussage, und sie ist hochaktuell: Was tust du in einer Zeit, die – so hat es zumindest den Anschein – alles vernichtet und profaniert und lächerlich macht, was über Jahrhunderte hinweg den Menschen Halt und Trost gegeben hatte, was im Lauf der Zeiten über und unter den Schicksalen der Einzelnen fester Boden und himmlischer Zielpunkt gewesen war? Aeneas floh über das Meer, als Troja fiel, germanische und mittelalterliche Könige und Kaiser gingen in den Berg ein. Hier ist es das alte Gemäuer, das den Schatz der Heiligkeit in sich aufnimmt und birgt. So bewahrt ausgerechnet der tote Stein das Leben, und so ist er, aller Vergänglichkeit zum Trotz, der Ort, in dem die Zeit nicht nur aufgehoben ist, sondern aus dem sie auch wiederkommen kann: Was wirklich wichtig ist und trägt, so die tröstliche Aussage, kann nicht vernichtet werden, es kann nicht untergehen. Und so ist es immer. Ein starkes Symbol.
Und dennoch: Wir fassen gerade hier, ungeachtet der Kraft der zentralen Aussage, auch die Crux, die einigen der vorgestellten Erzählungen gemein ist. Die Frage ist ja, wie die vorgestellten Geschichten uns in unserer Situation weiterhelfen können. Ein Autor transportiert eine Absicht, und er transportiert Bilder und Anschauungen. Literatur ist aber, vor allem anderen, in Bilder und Anschauung und Sprache gefaßte und verdichtete Wirklichkeit. Sie ist Erkenntnis, wenn sie denn einen Wert hat, der über den der Unterhaltung hinausgeht.
So kann ich, wenn ich in der Wahrheit bleiben will, über einige Schwächen Bergengruens nicht hinwegsehen: Die Erzählung ist der fiktive Bericht eines Hafenarbeiters, der als Kind, dessen Alter uns der Autor leider nicht verrät, den Untergang Konstantinopels mitangesehen haben will. Aber sein Bericht ist durchaus nicht der Bericht eines Kindes, auch nicht im Rückblick. Dazu sind die vorgestellten Bilder zu allgemein gehalten und zu unbestimmt: Wir befinden uns irgendwo, nur nicht in der römischen Hauptstadt des Jahre 1453! Die Versuche des Autors, die fehlende Unmittelbarkeit durch zufällig eingestreute Details zu suggerieren, scheitern: So tut beispielsweise die Bemerkung nichts zur Sache, er erinnere sich noch genau an eine Frau, „die ein grünes Kleid mit Marderbesatz trug“: Das ist kein inneres Bild, sondern eine konstruierte Vorstellung. Trugen damals überhaupt Frauen grüne Kleider? Und falls ja, was für Kleider, was für ein Grün? Dazu ein Marderbesatz – an einem 29. Mai? Und ausgerechnet dieses Detail soll sich dem Knaben bei Todesangst eingeprägt haben? Das ist keine Proust’sche Madeleine, deren Geruch eine ganze Welt der Erinnerung herbeizaubert, das ist eine „gefakte“ Erinnerung ohne unmittelbare Anschauungskraft.
Mißlungen sind auch die beschriebenen Massenszenen: „Indessen schlugen schon von draußen her die Äxte der Ungläubigen gegen die Tore, welche verschlossen worden waren“: Das ist eine generalisierende Beschreibung von oben her, nach Art eines Wimmelbildes, der schematische Aufruf eines Durcheinanders, aber keine unmittelbare Beobachtung, schon gar nicht die eines Kindes.
Und das gilt dann eben auch für die Zentralstelle des Textes: „Hier, so gewahrte ich, geschah noch etwas in der gleichen Weise, wie es seit je geschehen war, und so gab es denn ein Unverrücktes und Dauerndes inmitten aller Furchtbarkeit und Wirrnis.“ Als Zusage metaphysischen Trostes, als Verweis auf den Grund unserer Hoffnung ist das, wie oben gesagt, eine große Aussage. Aber als fiktive Erinnerung aus Kindertagen, selbst wenn sie aus der Rückschau eines Erwachsenen niedergeschrieben ist, meines Erachtens ausgeschlossen. Das ist ein Traktat, auch ein guter Traktat, aber keine Literatur! So fällt die Bilanz, was die Erzählung Bergengruens betrifft, ambivalent aus – ein großartiges, nachdrückliches Bild, aber keine glaubwürdige, plausible Umsetzung. Und so ist damit für das 21. Jahrhundert wenig gewonnen.
Edzard Schaper: „Stern über der Grenze“
Die meines Erachtens beste Erzählung des Reigens hieß ursprünglich: „Semjon, der ausging, das Licht zu holen“ von 1936. Nun legt gerade diese Geschichte dem Verständnis nicht unbeachtliche Hindernisse in den Weg. Doch ist gerade sie so wertvoll zur Scheidung der Geister. Wer sich die Mühe macht, die Nuß zu knacken, wird wertvolle Nahrung bekommen. Die hervorragende Einführung von Uwe Wolff ist eine große Hilfe dazu.
Bei Schaper geht es um eine Erfahrung der Grenze in all ihrer Bedeutungsschwere und Tiefe. Äußerlich spielt die Geschichte auf der kalten Grenze zwischen dem Estland der 1930er Jahre und dem anschließenden Sowjetrußland, also auf einer schwerbewachten, „tödlichen“ Demarkationslinie mit dem ganzen Schrecken, der von solchen Linien ausging und wovon jeder noch eine Ahnung hat, der vor 1989 gelebt hat. Diese Grenze wird aber auch zum Bild der anderen Grenze, die unser Leben be-endet, zur Grenze von Licht und Finsternis, von Wärme und unerbittlicher Kälte, von Leben und Tod. Damit aber auch zur Grenze zwischen dieser Welt und der verborgenen, nur dem Gläubigen zugänglichen, zu der Grenze, die nur überschreitet, wer tatsächlich Christus begegnet. Alle diese und noch weitere Grenzen überschneiden sich hier, in diesem existentiellen Niemandsland, und es ist gar nicht so leicht zu wissen, auf welcher Seite der Grenze man sich jeweils gerade befindet. Und immer ist die Angst da, die wie die Kälte in die Knochen steigt, es könnte alles verloren sein und der Tod das letzte Wort behalten.
Was also macht diese Geschichte gerade in der heutigen Zeit so wertvoll? Daß sie eine Antwort findet auf die Not einer Zeit, die im Todesschatten lebt, gerade aber auch, daß es keine leichte, oberflächliche, beruhigende Antwort ist. Diese Geschichte beschwichtigt die aufkommenden Fragen nicht, sie ruft sie vielmehr auf und verschärft sie. Und findet doch eine Antwort, die allein überhaupt in der Lage sein mag, die aufkommenden Fragen zu beantworten. „Ich bin überzeugt, daß die Leiden dieser Welt nichts sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll.“ Diesen Satz des hl. Paulus (Röm 8,18) möchte man über diese Geschichte setzen, über diese Geschichte, die uns zeigt, wie tief unsere Vorfahren über diese Fragen nachgedacht haben. Wenn unsere Zeit derartige Geschichten heutzutage meist abtut, spricht das nicht gegen Schaper, es stellt vielmehr unserer Zeit kein gutes Zeugnis aus. Es liegt an unserer fehlenden Bereitschaft, sich den metaphysischen Grenzfragen in aller Ungeschütztheit auszusetzen.
Insofern ist in meinen Augen keine Geschichte so gut geeignet wie diese, das eigentliche Anliegen des vorliegenden Bandes zu zeigen: Denen, die sich auf den Weg in die tiefen Kammern der jüngeren Vergangenheit machen, zu zeigen, daß es dort veritable Schätze zu finden gilt – auch wenn sie sich nur denen zeigen, die bereit sind, den mühsamen Weg tatsächlich hinabzusteigen. Und die Geschichte ist aktuell: Wo läuft die Grenze zwischen Glauben und Unglauben heute? Wo lebt die Kirche wirklich, die wahre Kirche, wo ist ihr echtes und eigentliches Leben in einer Zeit, da die Öffentlichkeit sie meist nur noch als „Beerdigungsverein mit Immobilien in 1A-Lage“ (Arnold Stadler) wahrnimmt. Die Hoffnung, zeigt uns diese Erzählung, ist gerade da zu finden, wo man sie am wenigsten zu finden meint. Aber wer, auf unserer Seite der Grenze, mag sagen, was das für ein Licht war, das da aufschien – der Scheinwerfer eines sowjetischen Grenzsoldaten oder das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet? Schaper macht seine Leser zu Seiltänzern – da will ein Abgrund bestanden sein!
Und die anderen Autoren? Alle führen sie in die Tiefe; alle Werke sind, auf den ersten Blick erkennbar, Frucht eines sehr ernsthaften geistlichen Ringens. Und wo findet man etwas Derartiges heute noch? Der Mensch kann aber nur leben, wenn er Antworten findet auf die „tragische Trias“ von Leid, Schuld und Tod, von der Viktor Frankl sprach – vegetieren kann er auch so. Liest man die Geschichten, kann man lernen, wie viel wir verloren haben und wie sehr wir dazu neigen, der Vergangenheit Unrecht zu tun, indem wir sie nicht kennen. Denn erst, wenn du verstanden hast, wirst du überhaupt damit anfangen können, dir ein Urteil zu bilden.
Und dennoch: Nachdem sich Edgar Degas, der bei aller Liebe eben doch kein Dichter, sondern ein Maler war, einen ganzen Tag lang vergeblich mit der Arbeit an einem Sonett abgeplagt hatte, gab ihm Mallarmé in profunder Kürze zu verstehen: „Mais, Degas, ce n’est point avec des idées, que l’on fait des vers … C’est avec des mots.“ Gedichte bestehen aus Wörtern, nicht aus Gedanken! Auch ein Martin Mosebach weiß, warum er keinen christlichen Roman schreibt. Einige der vorgestellten Geschichten wären als Essay hervorragend gewesen, einige bilden einen ebenso interessanten wie komplexen Gedankenteppich, der die geistliche Seite des Lebens ernst nimmt und erhellt, wenn man auf diese Ebene, je nachdem, hinab- oder hinaufsteigt – als Literatur machen sie aber auch die Erschütterung des katholischen Daseinsgefühls schon vor dem II. Vatikanischen Konzil sichtbar. Alle zeigen sie, wie angefochten die Gläubigen damals bereits waren. Insofern eignen sich die Texte auch zur Zeitdiagnose. Und auch das ist ja nicht der geringste Wert von Literatur.
Das letztliche Scheitern des Renouveau Catholique ist sicher nicht nur der Mißgunst der Zeiten zuzuschreiben. Der Versuch, dem inneren Ringen von Glauben, Versuchung und Gnade mit literarischen Mitteln beizukommen, muß ein steiles Unterfangen sein und beinhaltet immer die Gefahr des Absturzes. Ich meine, daß man gut daran tut, selbstkritisch zu sein. Und das heißt, zu loben, was – literarisch – gut ist und bestehen wird, Zurückhaltung zu üben, wenn etwas nur gut gedacht oder gar nur gut gemeint ist. Der vorliegende Band enthält Geschichten beiderlei Qualität. Und so kann man schon allein dadurch hier viel lernen. Ein Buch, das zu lesen sich lohnt – ungeachtet der Kritik und allein schon aufgrund der hervorragenden Einführungen.