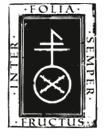LOGBUCH LXXVI (17. August 2025). Von Beate Broßmann
Wieder ein Gemälde. Und erneut die westdeutsche High Society. Auch der traditionelle Erzählstil des Romans, der so gar nicht zu den Verhaltensweisen der dramatis personae passen will, wird vom Autor beibehalten. Doch stimmt das überhaupt? Könnte dieser Roman nicht auch vor einhundert Jahren verfaßt worden sein? Fällt nicht nur ein Aspekt des auf diese Weise geschilderten deutschen Lebens aus der Zeit: die Allgegenwart von in Deutschland lebenden und arbeitenden Ausländern, deren Worte und Sätze oft kaum zu verstehen und deren Gedanken fremd sind und bleiben? Ist die Beibehaltung einer bewährten, klassischen Ästhetik womöglich nicht nur Ausdruck kulturkonservativer Sturheit, sondern Programm? Seht her: Es hat sich nicht so viel geändert, wie es an der Oberfläche erscheint? Das gesellschaftliche Koordinatensystem ist das gleiche wie 1925, beispielsweise. Die Beziehungsformen der (deutschen) Menschen zueinander desgleichen. Und ihre Gefühle, Strebungen, Bedürfnisse, Impulse sowieso. Bevor der Transhumanismus die Natur des Menschen verändert haben wird, bleibt er der alte Adam und sie die alte Eva, Gendergedöns hin oder her. Letzten Endes ist es ja genau dieser alte Adam, der immer wieder so schlecht zu den Verhältnissen paßt, seien sie auch von Wesen der eigenen Gattung selbst erschaffen, der die Idee der notwendigen Verbesserung, Überarbeitung, Erziehung virulent bleiben läßt. Und angesichts von acht Milliarden Exemplaren auf der kleinen Erde kommt eben der eine oder andere einflußreiche Pragmatiker zu der Überzeugung: Wir haben im Guten alles versucht, um den Menschen zu einem sozialen, zivilisierten Wesen zu machen – jetzt muß eine technische Lösung her! Bevor dieser Prozeß des „Great Reset“ richtig in Gang kommt, möchte der Autor Martin Mosebach sie vielleicht einfach noch einmal darstellen, wie sie sind, die Menschen in ihrer Gemeinheit, ihrer Schwäche, ihrer Abgründigkeit, Verletzlichkeit und Aggressivität. Und in ihrer archaischen Körperlichkeit, die angesichts des Grades der Technisierung in allen Bereichen bereits heute anachronistische Züge trägt. So war er, der Mensch, das Schwein. Alles andere ist Lametta.
Der Autor greift in die Vollen der deutschen Sprach- und Kulturgeschichte und bedient sich ihres sprachlich-geistigen Höchststands, um die Gegenwart zu beschreiben und noch einmal diejenigen zu beschenken, die sich der tiefen Tragik des Kulturverlustes bewußt sind und gewöhnlich ihre ästhetischen Formbedürfnisse mit Büchern aus einer anderen Zeit befriedigen. Allen anderen: gute Unterhaltung mit den Hauptstrom-Romanen!
Denn die Sprache ist das Werkzeug, das unsere Wahrnehmungen interpretiert. In seinem letzten Roman „Taube und Wildente“ faßte Mosebach das modisch-unerzogene Kind und sein Verhalten in altmodische Worte und Sätze und überführte sie damit in andere, vergangene Sinnzusammenhänge. (Im Grunde dekontextualisierte er sie auf diese Weise und verstieß gegen das „Gebot“, jeden Erkenntnisgegenstand aus seiner Zeit heraus zu erklären und zu bewerten.) Diese Vorgehensweise setzt den Glauben an Ewiges, ewig Gültiges, absolute Werte und Normen voraus. Wahrscheinlich findet auch mancher Atheist den Rückgriff auf vergangene Sprache reizvoll. Doch bei ihm wäre er ein ästhetisches Experiment, der Aufbau eines zusätzlichen Spannungsfeldes, ein Aspekt der Verfremdung. Nicht so bei Mosebach. Dieser ernstet beim Spiel.
Manch einer empfindet Mosebachs Sprachpraxis allerdings als artifiziell. Auf der Innenseite des Schutzumschlages ist ein Zitat aus der NZZ zu lesen. Manfred Papst schreibt: „In seinem souveränen Manierismus ist er der Thomas Mann unserer Tage.“ Wenn man zu Superlativen greifen will: Mag sein. Mir drängt sich die innere Verwandtschaft des Romans mit Robert Musils „Mann ohne Eigenschaften“ (1930/32) auf. Mindestens in einem erzählerischen Motiv: Mosebachs Figuren Ed Weiss und Flora Ortiz verweisen auf Musils Prostituiertenmörder Moosbrugger. Interessant sind sowohl Übereinstimmungen als auch Unterschiede zwischen den Rollen, die die drei Außenseiter aus der Unterschicht von ihren Erfindern zugewiesen bekommen.
Christian Moosbrugger, ein Mann aus ärmsten Verhältnissen, sitzt im Gefängnis, weil er einen Mord begangen hat, und das war nicht sein erster. Er wird aufgrund seiner Wahnvorstellungen als verrückt angesehen und dennoch als zurechnungsfähig im juristischen Sinne. Er wird zum Tode verurteilt. Musils Held Ulrich interessiert sich für ihn und sein Werden in ähnlicher Weise, wie es auch die Wissenschaftler der verschiedenen Sparten und die Journalisten tun. Er lernt ihn kennen und sieht in ihm einen Mann, der ihm fremd ist, aber nicht fremder als jeder andere auch. In seiner Außenseiterrolle sieht Ulrich sich sogar verwandt mit dem Gewaltverbrecher. Auch eine andere Figur des Romans fühlt sich in einer fragwürdigen Weise zu Moosbrugger hingezogen: Die psychisch labile Clarisse will in Ermangelung sonstiger sinnvoller Aufgaben in ihrem Leben die Seele des Mörders retten, ihn erlösen. Aber ihr psychischer Zustand verschlechtert sich in der Folge. Ihr Ehemann Walter ist nicht der große Künstler geworden, als den sie ihn gesehen hat. Enttäuschung und das Gefühl der Haltlosigkeit zwingen sie zur Sinnsuche.
Die Konstellation bei Mosebach ist ähnlich: Der erfolgreiche, selbstgefällige und wohlhabende Maler Louis Creutz, Hauptfigur der Handlung und Teil eines saturierten, bildungsbürgerlich-mondänen Freundeskreises, unterhält Beziehungen zu einem alten Schulfreund, der seit langem im halb- und unterweltlichen Milieu zu Hause ist, und zu einer obdachlosen Stadtstreicherin, einer Flaneuse des Grauens.
Ed Weiss hat bereits seit seinem elften Lebensjahr mit Drogenhandel zu tun, und es folgt eine Karriere als Klein- bis Mittelkrimineller. Zum Gefängnis unterhält er eine An-/Aus-Beziehung. In unregelmäßigen Abständen taucht er im Atelier von Louis Creutz auf. Dieser läßt dann alles stehen und liegen und unternimmt eine Sauftour mit ihm durch Nachtlokale, Clubs und Bars, in denen er ohne diesen Guide nie gelandet wäre. Die beiden verbindet nichts als ihre Kindheit und die Blutverwandtschaft, die sie empfinden. Sie sind sich der Unvereinbarkeit ihrer beiden Lebenswelten bewußt. Weiss ist wortkarg und gut als Zuhörer zu gebrauchen für die selbstbespiegelnden Monologe des Malers. Darüber hinaus wünscht dieser allerdings, vom anderen in Ruhe gelassen zu werden. Über Privates sprechen sie grundsätzlich nicht. „Daß Louis Creutz den Anruf eines Anwalts erhielt, der ihn um ein Gespräch wegen Ed Weiss bat, war in ihrem Verhältnis nicht vorgesehen. Niemals hatte es Dritte zwischen ihnen gegeben, schon gar keine gemeinsamen Bekanntschaften, die ersparten sie einander.“ (265) Der Maler ist zunächst fassungslos, danach wütend. Weiss sitzt in Untersuchungshaft, und Creutz will nicht einmal wissen, warum. Auch der Leser erfährt es nicht. Des Winkeladvokaten Ziel ist es, den Jugendfreund seines Mandanten zu bitten, diesem ein Alibi zu geben. Er sei mit ihm an dem betroffenen Tag zusammen in seinem Atelier gewesen. Creutz’ spontane innere Reaktion: „… so etwas durfte nicht eintreten, hatte aber, trat es dennoch ein, die Konsequenz, die Freundschaft mit einem Schlag auszulöschen. Mehr als einmal brauchte mit einer solchen Zumutung nicht gerechnet werden.“ (171) „Diesmal hatte er es zu weit getrieben, das reicht für immer.“ (179) Weiss’ Verhalten sei rücksichtslos, übergriffig und nicht zu dulden. Er bittet den Anwalt, seinem „Freund“ auszurichten, daß er nicht in dessen Angelegenheiten hineingezogen werden wolle. Er gedenke nicht, irgendeine Aussage zu machen. Bei der kurzen Begegnung der beiden Männer im Besucherraum des Gefängnisses (die gleiche Konstellation wie zwischen Urich und Moosbrugger) kommt es nur zu Smalltalk und der flehentlichen Bitte des Delinquenten: „Es muß gelingen, zu beweisen, daß ich es nicht gewesen sein kann, was ja auch wirklich so ist …“ Er sucht in der Miene des anderen nach einem Zeichen, einer Regung, aber dieser reagiert nicht. „Er nickte Ed Weiss zu. Der sah ihn immer noch an, als ob er eine Lösung von ihm erhoffte, und blieb einen Augenblick stehen, als Louis Creutz ihm schon den Rücken zugewandt hatte.“ (281)
Doch dann kommt diesem eine Idee: Könnte er nicht einen Vorteil aus dem Fehler ziehen, den Weiss sich erlaubt hat? An dem betreffenden Tag ist nicht sein Blutsbruder, sondern sein Modell Astrid bei ihm gewesen. Aus heiterem Himmel hat sie ihn beschimpft und – wie er es empfindet – in seiner Ehre getroffen und ist dann fluchtartig verschwunden. Das Bild wird nun wohl unvollendet bleiben. Die schöne (klassische) Maler-Modell-Beziehung hat Astrid auch zerstört. Die Erinnerung an dieses Erlebnis ist Creutz äußerst unangenehm, und er würde es gern ungeschehen machen. „Am besten hatte es gar nicht stattgefunden. An jenem ominösen 13.9. war sie gar nicht bei ihm gewesen.“ (280) Dem Winkeladvokaten teilt er seine revidierte Entscheidung mit: Ja, er habe den besagten Tag mit Ed Weiss verbracht.
Das ist raffiniert vom Schriftsteller eingefädelt, allerdings auch ein bißchen weit hergeholt. Autosuggestives, bewußtes Überschreiben der eigenen Erinnerung, vulgo Selbstbetrug, als Ausgangspunkt für Lebensentscheidungen? Das klingt deviant. Und vielleicht verbindet ihn diese Schlagseite auch mit dem Modell Flora Ortiz. Die somnambule großgewachsene, spindeldürre und mit einem schwarzen Umhang bekleidete manische Stadtläuferin besucht ebenfalls in unbestimmten Abständen das Atelier. Sie ist gekleidet im Bettlerstaat orientalischen Charakters. Ihr Gesicht von spätantiker Schönheit, ihre Augen übergroß – sie durchbohren das Nichts – ihre Nase griechisch. (Prinz Yussuf läßt grüßen.) Steht sie untätig vor einem Café oder Restaurant, ist es, „als sei sie von einer bösen Ahnung erfüllt, was der sorglos schwatzenden Menge bevorstehe –, als schaue sie den Riesenhammer, der schon bald auf die in ihrer Nichtigkeit schwelgenden Kaffeehausgäste niedersausen würde. Und der dieses Volk nicht grundlos vernichtete, weil es viel zu lange schon in Gedankenlosigkeit und Frivolität verharrte.“ (171)
Als sich Astrid und die heilige, schweigende Pilgerin einmal zufällig im Atelier treffen, stellt der Maler sie in deren Beisein vor: „Ich habe sie gemalt, aber da war sie noch in besserer Verfassung, nie wirklich schön, ihr Körper schon gar nicht: mager, die Schulterblätter wie verkümmerte Flügel herausstehend, …, die Haut von diesem schmutzigen Weiß wie heute, obwohl sie unter der Dusche gewesen war.“ (173f.) Und dann spricht das Wesen Astrid an: „Werden Sie nicht sein Modell! Machen Sie das nicht!“ Bevor Astrid reagieren kann, hält der Künstler – amüsiert lächelnd – seinem ehemaligen Modell einen großen Schein hin. „Komm, du Tierchen, jetzt reicht’s.“ Zweimal hat er sie in die Psychiatrie gefahren, gegen ihren Willen, sie gewaltsam in seinen Wagen schiebend. Ihre „heulende, kaum menschliche Stimme“ hat im Treppenhaus des Fabrikgebäudes widergehallt.
Derart zynisch ist Ulrichs Beziehung zu Moosbrugger nicht gewesen. Aber vielleicht liegt hier auch ein Nucleus für den Wandel des Verhältnisses der (Groß-)Bürgerlichen zur Unterschicht innerhalb eines Jahrhunderts: Von einer mitfühlend-naturwissenschaftlichen Beobachtung bzw. dem Triggern des Helferimpulses damals hin zu mitleidlosem Benutzen des Menschenmaterials für eigene Zwecke einhundert Jahre später. Der Wert des Menschen sinkt mit seiner scheinbar grenzenlosen Vermehrung. Das Bedürfnis nach Besonderung wächst. Und die stärksten Distinktionsmerkmale sind nun einmal Reichtum und Prominenz.
„Die Richtige“ greift das oft in der Kunst verarbeitete Motiv von Maler und Modell auf originelle Art auf. Allerdings kommt die Handlung etwas auf Stelzen daher. An Komplexität erreicht dieser Roman seinen Vorgänger nicht. Und war „Der Mann ohne Eigenschaften“ noch ein experimenteller, avantgardistischer Roman der Moderne, zieht sich Mosebach auf eine Ästhetik des 19. Jahrhunderts zurück. Eher Fontane als Musil oder Mann. Doch hat es wirklich Sinn, von der Selbstbedienung eines alten weißen Mannes gegenüber einem Modell zu berichten, als hätte es die #MeToo-Debatte und die neofeministische Bewegung nicht gegeben? Sollte man sich ihr nicht besser – offensiv – stellen? Zeitlos übergriffige reiche Machos haben wir oft genug z. B. in den zahlreichen Claude-Chabrol-Filmen in Aktion sehen können.
Jedoch: Geriet Thomas Manns Erzählung „Die Betrogene“ von 1953 mit ihrer Darstellung einer scheinschwangeren Mittfünfzigerin meines Erachtens zu einer einzigen Peinlichkeit, läuft Martin Mosebach bei seiner Darstellung weiblicher Körperlichkeit zur literarischen Höchstform auf. Seine Beschreibung einer Fehlgeburt sucht ihresgleichen.
Martin Mosebach: Die Richtige. Roman. München: DTV 2025. 352 S. 26 Euro.
Abbildung: Felix Nussbaum: Maler und Modell (1938, Wikimedia Commons)